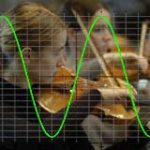Videobeweis: Die höchsten Töne des Operngesangs werden anders erzeugt als bislang angenommen, wie Forscher herausgefunden haben. Demnach geht diese „Pfeifstimme“ doch nicht auf einen ähnlichen Mechanismus wie beim Ultraschallgesang der Mäuse zurück. Stattdessen bewegen sich die Stimmlippen der Sängerinnen auch bei hohen Arien ähnlich wie bei Tönen der tieferen Tonlagen, wie Aufnahmen mit speziellen Kameras beweisen. Doch warum gelingen dann nicht allen Menschen so hohe Töne?
Unsere Stimme hat einen gewaltigen Tonumfang. Doch nur sehr wenige Menschen können alle theoretisch möglichen Töne auch praktisch erzeugen. Zu ihnen zählen Opernsängerinnen, die dank langem Training selbst die extremen Grenzen ihres Stimmumfangs nutzen können.
Bislang sind Gesangstrainer und Wissenschaftler allerdings davon ausgegangen, dass dies nicht ausschließlich durch Gesang über die Stimmbänder passiert, sondern auch durch andere Lautäußerungen. Die höchsten Töne des klassischen Gesangs werden demnach mit der „Pfeifstimme“ erzeugt. Dieses Pfeifen wird bisheriger Annahme zufolge nicht durch die Vibration der Stimmbänder, sondern durch die Wechselwirkung der Luft mit feststehenden Strukturen des Atemtrakts erzeugt – ähnlich wie der für uns nicht hörbare Ultraschallgesang bei Ratten und Mäusen.
In den Hals geschaut
Ein Forschungsteam um Matthias Echternach vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München hat diese Theorie nun erstmals experimentell überprüft. Dafür baten sie neun professionelle Opernsängerinnen, besonders hohe Töne zu erzeugen, die etwa drei Oktaven über der normalen Tonhöhe liegen. Währenddessen machten sie Videoaufnahmen von ihren Stimmlippen.