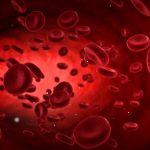Die innere Uhr von Feldhamstern steht während des Winterschlafes still. Dies hat jetzt ein internationales Forscherteam in einer neuen Studie erstmals nachgewiesen. Die Wissenschaftler widerlegen damit eine alte Hypothese, nach der die innere Uhr den niedrigen Körpertemperaturen im Winterschlaf von ungefähr vier bis acht Grad Celsius trotzt und als Kontrollmechanismus für die zeitlichen Abläufe physiologischer Funktionen in der Ruhephase fungiert.
Die innere oder auch circadiane Uhr steuert bei Säugetieren und damit auch beim Menschen den Tagesablauf. Sie gibt vor, wann wir müde werden, wann wir hungrig sind und wann wir aufwachen. Lokalisiert ist sie in den so genannten Suprachiasmatischen Nuklei (SCN), einer Zellansammlung im Gehirn. Dort werden in einem circa 24-stündigen Rhythmus die so genannten Uhren-Gene aktiviert oder gehemmt. Sie sorgen dafür, dass durch bestimmte Stoffe, beispielsweise Hormone, die „Uhrzeit“ an den Körper übermittelt wird.
Der prominenteste Zeitanzeiger ist das Hormon Melatonin, das nachts im Pinealorgan, einem kleinen Organ im Zwischenhirn, hergestellt wird und beim Menschen Schlaf fördernd wirkt. Es gibt zudem Auskunft über die zu- oder abnehmende Tageslänge und beeinflusst beim Feldhamster dadurch saisonale Anpassungen wie beispielsweise Fellwechsel, Gewichtszyklen und Winterschlaf.
Uhren-Gene untersucht
Annika Herwig aus dem Institut für Zoologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover konnte gemeinsam mit den französischen Wissenschaftlern Paul Pévet und Florent G. Revel aus dem Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives auf molekularer Ebene zeigen, dass diese Mechanismen bei Feldhamstern während des Winterschlafs abgestellt sind. Untersucht hat sie die Uhren-Gene Per1, Per2 und Bmal1 sowie ein Gen, das die Melatonin-Produktion reguliert.