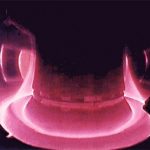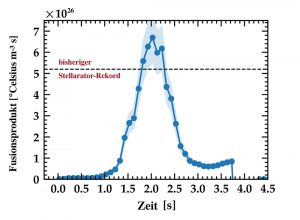Wenn es um die Energiegewinnung durch Kernfusion geht, hat das Bauprinzip des Tokamak bisher die Nase vorn – es wird unter anderem beim Forschungsreaktor ITER umgesetzt. Doch jetzt ist es Physikern gelungen, eines der großen Probleme beim konkurrierenden Stellarator zumindest einzudämmen: Plasmatests am deutschen Testreaktor Wendelstein 7-X belegen, dass die optimierten Magnetfelder die Energieverluste des Plasmas signifikant gesenkt haben.
Die Kernfusion gilt als eine Option für die Energiegewinnung der Zukunft. Bisher hat jedoch keines der beiden grundsätzlichen Bauprinzipien solcher Anlagen Kraftwerksreife erreicht. Tokamaks wie im Forschungsreaktor ITER haben den Vorteil, dass ihre Magnetfelder relativ einfach strukturiert sind und wenig Plasmaenergie nach außen entweichen lassen. Dafür kann ein solcher Reaktor immer nur schubweise gezündet werden. Im Gegensatz dazu kann ein Stellarator im Dauerbetrieb laufen – und wäre daher theoretisch für ein Kraftwerk besser geeignet.
Zu viele Wellen und Lücken im Käfig
Das Problem jedoch: Beim Stellarator wird das heißen Plasma von einer komplexen Anordnung ringförmiger Magnete in Form gehalten. Das entstehende Magnetfeld ist in sich verdrillt und zwingt das Plasma in eine wellige, spiralig verdrehte Form. Dies führt aber dazu, dass Plasmateilchen trotz ihrer Bindung an die magnetischen Feldlinien nach außen driften und verloren gehen. Sie entweichen durch winzige Lücken im Magnetkäfig und verringern so die Dichte und Energie des verbleibenden Plasmas.
Diese sogenannten „neoklassischen“ Energieverluste machen die bisherigen Stellaratoren ineffektiv. Mehr Energie herauszuholen als man durch die Heizleistung hineinsteckt, wäre so unmöglich. Zudem die Verluste wachsen mit steigender Plasmatemperatur so stark an, dass ein nach diesem Prinzip geplantes Kraftwerk sehr groß und damit sehr teuer sein müsste.