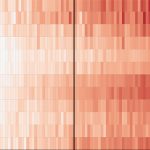„Dies eröffnet Austrittsmöglichkeiten für unter Druck stehende Grundwassersysteme, die zuvor durch das Gletschereis versiegelt waren“, erklären Kleber und ihre Kollegen. Als Folge bilden sich im Vorfeld der schrumpfenden Gletscher zahlreiche Grundwasserquellen, die dann auch im weiteren Verlauf ein Gefrieren des Bodens verhindern. Doch damit kann in diesen ungefrorenen Gletschervorflächen – Taliks genannt – auch zuvor unter dem Eis eingeschlossenes Methan zutage treten.
Methan-Freisetzung aus fast allen Quellen
Um zu ermitteln, ob und wie viel Methan in solchen Gletschervorflächen freigesetzt wird, haben Kleber rund ihr Team das Wasser von 123 Grundwasserquellen im Vorfeld von 78 Gletschern auf Spitzbergen analysiert. Das Ergebnis: Bei allen Quellen bis auf eine war das Wasser stark mit Methan angereichert.
„Die Grundwasserquellen sind mit Methan übersättigt und erreichen Konzentrationen von mehr als dem 600.000-Fachen des Gleichgewichtswerts mit der Atmosphäre“, berichten die Forschenden. Der Gleichgewichtswert beschreibt die Konzentration, bis zu der das Gas im Wasser gelöst bleibt. Ist mehr Methan im Wasser gelöst, geht es bei Austritt aus der Quelle in die Atmosphäre über. Bei den beprobten Quellen war dies bei fast allen der Fall.
Ursprung in unterirdischen Erdgas- und Kohlevorkommen
Wie viel Methan im Grundwasser gelöst ist, hängt dabei vor allem von der Geologie des Untergrunds ab, wie die Wissenschaftler erklären. Im Falle ihrer Quellen identifizierten sie kohlenstoffreiche Gesteinsschichten im Untergrund, darunter vor allem Schiefer, sowie unterirdische Erdgas- und Kohlevorkommen als primäre Quelle des Gases. „Die Geologie im zentralen Spitzbergen umfasst ein bekanntes System solcher Vorkommen, die sich bis in die küstennahen Meeresgebiete erstrecken“, berichten sie.
Das in solchen Gesteinsschichten vorhandene Methan kann über Gesteinsporen und Risse ins Grundwasser übergehen und an die Oberfläche steigen. Solange der Gletscher diese Gebiete überdeckt, bleibt das Gas jedoch größtenteils im Untergrund gefangen. Zieht sich das Eis aber zurück, kann das mit Methan gesättigte Grundwasser und auch das im Sediment vorhandene Gas zutage treten. Auch Methan aus mikrobiellem Abbau kann – wenn auch in geringerem Maße – zu den Emissionen beitragen, wie Kleber und ihre Kollegen erklären.
Vorgeschmack auf ein unfassenderes Problem
Auf Basis ihrer Proben haben die Forschenden errechnet, dass allein die 78 von ihnen untersuchten Gletscher zwischen 27 und 230 Tonnen Methan pro Jahr freisetzen. „Wenn wir dies auf ganz Spitzbergen hochrechnen, ohne dabei regionale Unterschiede der Geologie zu berücksichtigen, ergeben sich für alle proglazialen Grundwasserquellen dieses Archipels Emissionen von 2.310 Tonnen Methan pro Jahr“, berichten Kleber und ihr Team. Angesichts der Tatsache, dass Spitzbergen sich doppelt so schnell erwärmt wie der Durchschnitt der Arktis, könnte dies jedoch sehr schnell mehr werden.
„Diese Quellen sind eine erhebliche und potenziell wachsende Quelle der Methanemissionen – und eine, die bisher in Schätzungen des globalen Methan-Budgets größtenteils fehlte“, sagt Kleber. Sie vergleicht Spitzbergen mit dem sprichwörtlichen Kanarienvogel im Bergwerk: Der Zustand dort nimmt voraus, was auch in anderen Regionen der Arktis noch folgen könnte. Denn auch in Teilen der kanadischen und russischen Arktis gibt es schrumpfende Gletscher und Erdgasreservoire im Untergrund.
Positive Rückkopplung im Klimasystem
Damit könnte der Rückzug der arktischen Gletscher eine weitere positive Rückkopplung im Klimasystem initiieren: Je mehr Böden von den Gletschern freigelegt werden, desto mehr Methan könnte dort austreten. Dies wiederum trägt zum Treibhauseffekt bei und heizt die arktische Atmosphäre noch weiter auf. „In Spitzbergen beginnen wir zu verstehen, welche komplexen und kaskadierenden Rückkopplungen durch die Gletscherschmelze ausgelöst werden“, sagt Kleber.
Anders als der Permafrost, der nur sehr langsam auf die Erwärmung reagiert, kommen diese gletscherbedingten Veränderungen deutlich schneller zum Tragen. „Die Studie zeigt, dass es wichtig sein könnte, zurückweichende Gletscher als Methanquellen im Auge zu behalten – insbesondere dann, wenn durch den Klimawandel immer größere Gletscherflächen verschwinden“, kommentiert der nicht an der Studie beteiligte Atmosphärenphysiker Friedemann Reum vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. (Nature Geoscience, 2023; doi: 10.1038/s41561-023-01210-6)
Quelle: University of Cambridge
7. Juli 2023
- Nadja Podbregar