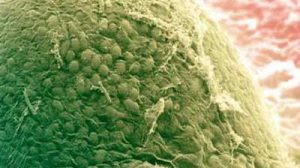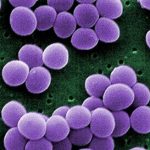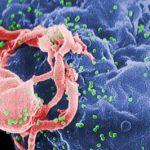Er benötigt eine Süßwasserschnecke als Zwischenwirt, um infektionsfähige Zerkarien zu erzeugen und ins Wasser abzugeben. Wenn jedoch die Artenvielfalt unter den Süßwasserorganismen sehr hoch ist, landet ein Großteil der Larven nicht in der passenden Schnecke sondern irrtümlich in einem anderen, unpassenden Wirt. Als Folge reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für die spätere Infektion eines Menschen um 25 bis 99 Prozent.
„Puffer-Arten“ gegen Übertragung verschwinden
Ein weiterer Faktor, der zur Zunahme von Infektionen führen kann, ist das Verschwinden von so genannten „Puffer-Arten“ – Konkurrenten oder natürlichen Feinden der Zwischenwirte und Überträger. Die Forscher stellten fest, dass dort, wo die Artenvielfalt beispielsweise durch das Zerstören und Fragmentieren von Lebensräumen leidet, tendenziell genau die Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen am schnellsten verschwinden, die zuvor als Puffer gegen eine Ausbreitung von Krankheiten dienten. Die Arten, die bleiben, sind dagegen meist Arten, die selbst Überträger sind oder den Krankheitserregern als Zwischenwirte dienen.
Einer dieser Fälle ist die Borreliose, im anglo-amerikanischen Raum auch Lyme Disease genannt. Die durch Bakterien verursachte Krankheit löst im Frühstadium grippeartige Symptome aus, kann später aber schwere Herz-, Gelenk- und Nervenschäden verursachen. In Europa wird sie vom gemeinen Holzbock Ixodes ricinus übertragen, in den USA von der Hirschzecke Ixodes scapularis. Wichtigster Wirt dieser Zecke im Tierreich ist die Weißfußmaus, eine Art, die sich wegen des Rückgangs ihrer Konkurrenten immer stärker ausbreitet.
„Stark limitierende Arten wie das Opossum gehen verloren, wenn die Wälder fragmentiert werden, doch die Weißfußmaus gedeiht“, erklärt Richard Ostfeld vom Cary Institute of Ecosystem Studies. „Die Mäuse wiederum fördern die Zunahme sowohl der Hirschzecke als auch des Krankheitserregers, der die Lyme-Krankheit auslöst.“ In Experimenten zeigte sich, dass das Opossum bei Putzen seines Fells die meisten Zecken entdeckt und tötet, nur wenige infizierte Zecken überleben. Die Weißfußmaus dagegen findet und tötet nur rund die Hälfte der an ihr saugenden Zecken, von den Überlebenden wiederum ist ein Großteil mit Borrelien infiziert.
Habitatschutz als Infektionsschutz
Noch wissen die Forscher nicht, warum ausgerechnet die widerstandsfähigsten Arten diejenigen sind, die den Krankheitserregern als Vektor dienen. Doch ihrer Ansicht nach ist in jedem Falle der Schutz der natürlichen Habitate der beste Weg, diesen Effekt zu verhindern. „Der schützende Effekt der Biodiversität ist deutlich genug, so dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, um sie zu erhalten“, so Keesing.
Neben der Artenvielfalt spielen jedoch auch weitere Faktoren wie Veränderungen der Landnutzung und das Bevölkerungswachstum eine Rolle für die verstärkte Ausbreitung von von Tieren übertragenen Krankheiten. Die Hälfte aller von Tieren übertragenen Krankheiten, die seit 1940 neu aufgetreten sind, schafften den Sprung zum Menschen durch Änderungen der Landnutzung wie beispielsweise Waldrodungen, durch Veränderungen in der landwirtschaftlichen Nahrungsproduktion oder durch die Jagd und das Verzehren von Wild.
„Wenn die biologische Vielfalt sinkt und der Kontakt mit dem Menschen häufiger wird, dann hat man ein perfektes Rezept für neue Ausbrüche von Infektionskrankheiten“ erklärt Andrew Dobson von der Princeton Universität. Die Variablen genau zu identifizieren, die am Auftreten von Infektionskrankheiten beteiligt sind sei zwar schwierig, aber entscheidend, so der Forscher.
Stärkere Überwachung auch der Nutztierhaltung
Ist der Sprung des Krankheitserregers auf einen neuen Wirt einmal geschafft, spielt, so die Forscher, die Populationsdichte des neuen Wirts eine entscheidende Rolle. So sprang das Nirah-Virus in Malaysia zunächst von wilden Fruchtfledermäusen auf Hausschweine über. Die hohe Bestandsdichte der Schweine in den Farmen wiederum erleichterte die Übertragung von Schwein zu Schwein und letztlich auch die Infektion des Menschen.
Die Wissenschaftler fordern daher unter anderem dazu auf, Gebiete besonders genau zu überwachen, in denen große Anzahlen von Haus- und Nutztieren gehalten werden. „Das könnte die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass eine infektiöse Krankheit von Wildtieren auf Nutztiere und dann von diesen auf den Menschen überspringt“, so Keesing.
(Cary Institute of Ecosystem Studies, 02.12.2010 – NPO)
2. Dezember 2010