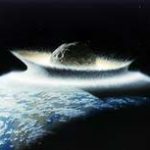Ein internationales Forscherteam hat zum ersten Mal die Auswirkungen von Artensterben auf ein komplettes Ökosystem untersucht. In aufwändigen Freilandexperimenten über einen Zeitraum von acht Jahren konnten die Wissenschaftler zeigen, dass sich der Artenverlust offenbar quasi „von unten nach oben“ in der Nahrungskette fortsetzt.
So zieht der Verlust einer Pflanzenart schneeballartig das Aussterben weiterer Arten nach sich. Dieser Prozess kann das gesamte Ökosystem destabilisieren, berichten die Wissenschaftler in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Nature“.
Wenn Pflanzenarten lokal aussterben, dann sterben als nächstes diejenigen Organismen aus, die direkt auf Pflanzennahrung angewiesen sind. Erst danach trifft es Organismen, die weiter oben in der Nahrungskette stehen, wie zum Beispiel räuberische Käfer. Bisher ging man davon aus, dass das Artensterben vor allem die empfindlichen Arten an der Spitze der Nahrungskette betrifft.
Artensterben wird vorhersagbar
„Wenn auch nur eine einzige Pflanzenart ausstirbt, dann gehen mit ihr oft eine ganze Menge weiterer Arten verloren“, erläutert Christoph Scherber von der Universität Göttingen. An der neuen Studie waren außer ihm über 40 Wissenschaftler aus Europa und Nordamerika beteiligt.
„Die Studie ermöglicht auch, Artensterben vorherzusagen und abzuschätzen, welche Tiergruppen am empfindlichsten darauf reagieren.“ Beispielweise tritt die Reaktion von Organismen, die im Boden leben, verzögert auf und fällt schwächer aus als die von oberirdisch lebenden Tieren.
Artenvielfalt unterdrückt Pilzbefall
Weiterhin konnten die Wissenschaftler zeigen, dass sich eine große Artenvielfalt der Pflanzen fast immer positiv auf die Artenzahl anderer Gruppen von Organismen auswirkt und damit auch wichtige ökologische Funktionen wie den Blütenbesuch durch Bestäuber und die Kontrolle von Pflanzenfressern fördert.
Außerdem unterdrückt Artenvielfalt den Forschern zufolge das Wachstum von Unkräutern und den Pilzbefall von Pflanzen. „Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass die Pflanzenvielfalt vor allem Arten und Funktionen fördert, die für den Menschen wichtig und erhaltenswert sind“, so Scherber und Professor Teja Tscharntke, Leiter der Abteilung Agrarökologie der Universität Göttingen.
Mehr Pflanzenarten, größerer Tierartenreichtum
„Dank unser detaillierten Auswertung konnten wir genau abschätzen, welcher Anteil am Tierartenreichtum durch die Vielfalt der Pflanzen und welcher durch den reinen Zugewinn an Biomasse erklärt wird“, erklärt Vicky Temperton vom Jülicher Institut für Bio- und Geowissenschaften.
Denn mehr Pflanzenarten führen in der Regel auch zu mehr Wachstum und damit zu einem größeren Nahrungsangebot für Tiere. „Aber die Daten zeigen signifikant, dass der Artenreichtum der Tiere im Ökosystem stärker mit der Anzahl der Pflanzenarten steigt, als alleine durch mehr Biomasse zu erklären ist.“
Im DFG-geförderten Großversuch wurde dazu regelmäßig die Menge an Pflanzenbiomasse verschiedener Pflanzenarten genau bestimmt – teilweise durch Probenentnahme, Sortieren nach Arten und Wiegen im Labor, teilweise durch visuelle Bestimmung der Arten im Feld.
Nachhaltige Produktion nachwachsender Rohstoffe
„Wir wollen nun die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung für Anwendungen umsetzen“, sagt Temperton. In nächsten Projekten will sie prüfen, wie marginale, also unfruchtbare Böden für die Bioökonomie nutzbar werden können. Positive Interaktionen zwischen bestimmten Pflanzenarten bedeuten, dass in Mischungen der Ertrag über längere Zeiten hoch bleiben kann.
„Außerdem sind Mischungen unterschiedlicher Pflanzenarten auf nährstoffarmen Wiesen energetisch sehr effizient, da sie sehr wenig Düngemittel oder Pestizide brauchen, aber der Ertrag nachhaltig ist. Solche Mischungen könnten dann etwa zur Biogasproduktion dienen“, so Temperton weiter. Dies wäre ein erster Schritt zur nachhaltigen Produktion nachwachsender Rohstoffe auf schwierigen Böden.
Rasantes Artensterben
Die Welt verliert zurzeit Tier- und Pflanzenarten mit einer rasanten Geschwindigkeit: Vor allem durch die Zerstörung von Lebensräumen sind heute etwa 30 Prozent aller Arten gefährdet.
(idw – Universität Göttingen/Forschungszentrum Jülich/UFZ, 28.10.2010 – DLO)