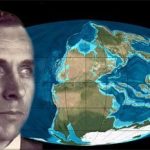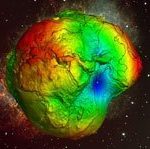Eine kilometerdicke Schicht geschmolzenen Gesteins nur 410 Kilometer unter der Erdoberfläche haben Wissenschaftler unter dem Südwesten der USA entdeckt. Wie sie in der Zeitschrift „Nature“ berichten, könnte diese Schicht eine bereits zuvor registrierte seismische Anomalität in dieser Tiefe erklären und möglicherweise eine 2003 aufgestellte Hypothese über das Aufsteigen von Mantelgestein im Untergrund bestätigen.
{1l}
Das Innere der Erde ist nicht einförmig, sondern besteht aus Gestein wechselnder Dichte und Zusammensetzung. Die Reflexionen und Brechungen von Erdbebenwellen in unterschiedlichen Tiefen belegen dies unter anderem. Eine dieser seismischen Grenzzonen liegt in 410 Kilometern Tiefe. Bisher war jedoch nicht genau bekannt, warum gerade dort. Bereits 2003 hatten allerdings Geowissenschaftler der amerikanischen Yale Universität eine Hypothese über die Zusammensetzung und den Zustand der Gesteine im Erdmantel publiziert, in dem diese Tiefe eine wichtige Rolle spielte: Sie gingen davon aus, dass hier aufsteigendes Mantelgestein das in seiner Kristallstruktur gebundene Wasser verliert und schmilzt.
Doch Belege für diese Hypothese gab es nicht. „Die Idee ist Eine kilometerdicke Schicht geschmolzenen Gesteins nur 410 Kilometer unter der Erdoberfläche haben Wissenschaftler unter dem Südwesten der USA entdeckt.interessant und wird unter Geophysikern kontrovers diskutiert“, erklärt James Tyburczy von der Arizona State Universität. „Daher dachten Dan und ich uns, wir testen es einfach.“ Doch so einfach war dies nicht, denn bisherige Methoden gaben zwar ein wenig Auskunft über Dichte und vor allem Dichteunterschiede, lieferten aber keine genaueren Daten über die Zusammensetzung des betreffenden Gesteins.
Leitfähigkeitsmessung mit „kosmischer“ Hilfe
Eine klassische geophysikalische Probentechnik, die Magnetotellurik, kann Veränderungen in der Leitfähigkeit von Gesteinen auch in Tiefen messen, die durch direkte Proben nicht erreicht werden können. „Gesteine sind Halbleiter und Gesteine, die mehr Wasserstoff in ihrer Kristallstruktur enthalten“, erklärt Tyburczy. „Sie leiten besser als Gesteine, die teilweise geschmolzen sind.“ Hauptquelle für den eingelagerten Wasserstoff ist meistens das Wasser, das in den Kristallen gebunden ist. Doch diese Methode hat ihre Grenzen, denn für mehrere hundert Kilometer Tiefe ist sie nicht ausgelegt.
Tyburczy und sein Kollege Daniel Toffelmier verfielen daher auf eine andere Idee: Sie holten sich „kosmische“ Hilfe – von der Sonne. Von ihr geht ein kontinuierlicher, aber in Stärke und Intensität variierender Strom von geladenen Teilchen aus, der Sonnenwind. Er beeinflusst das Magnetfeld der Erde und dies wiederum erzeugt schwache aber messbare elektrische Ströme im Untergrund. Langzeitmessungen dieser veränderlichen Ströme erlauben Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Gesteine – ähnlich der Magnetotellurik, aber mit größerer Reichweite in Bezug auf die Tiefe.
Felddaten deuten auf Schmelzschicht hin
Konkret begannen die Forscher mit einem Modell der Gesteinszusammensetzung in unterschiedlichen Tiefen und verglichen die darüber errechneten Daten mit den elektromagnetischen Messdaten. Sie korrigierten die Startparameter ihres Modells so lange, bis die Werte übereinstimmten. Dabei zeigte sich, dass die Daten für den Südwesten der USA nur dann passten, wenn im Modell die Existenz einer Schmelzschicht in 410 Kilometern Tiefe berücksichtigt wurde.
“Ohne eine solche Schmelzzone in dieser Tiefe können wir die Feldbeobachtungen nicht erklären“, so Toffelmier. „Aber als wir eine fünf bis 30 Kilometer dicke leitende Schmelzzone einfügten, erhielten wir eine bedeutend bessere Übereinstimmung.“ Die horizontale Ausdehnung dieser Schicht allerdings ist bisher unbekannt, da die Daten dies nicht hergeben. Zwar deuten die seismischen Messungen daraufhin, dass die 410-Kilometer-Störung global auftritt, die beiden Forscher glauben jedoch nicht, dass auch die Schmelzschicht durchgängig ist. Sie halten sie eher für fleckig verteilt. Die Hypothese der Yale-Forscher können die beiden Wissenschaftler daher nur in Teilen bestätigen. „Unser Modell hat nur eine Dimension, wir müssen jetzt anfangen, auch in zwei und drei Dimensionen zu schauen“, erklärt Toffelmier. „Wir haben gerade einmal die Spitze des Eisbergs gesehen.“
(Arizona State University, 22.06.2007 – NPO)