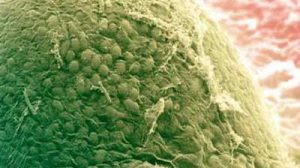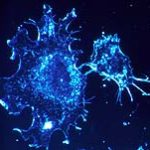Die Schere zwischen der höchsten und niedrigsten Sterberate klafft weltweit immer weiter auseinander. Das zeigt die jetzt in „The Lancet“ veröffentlichte bisher umfangreichste Studie der globalen Mortalität. Demnach haben männliche Isländer und Zypriotinnen das niedrigste Risiko, verfrüht, das heißt vor dem 60. Lebensjahr zu sterben. Die schlechtesten Chancen auf ein langes Leben bestehen in Swasiland.
.
Als Mortalität oder Sterberate bezeichnen Demografen die Anzahl der Menschen, die in einer bestimmten Gruppe, beispielsweise einer Altersstufe, sterben. Weltweite Zahlen dafür gibt es vor allem für die Kindersterblichkeit, aber auch für die Sterblichkeit von Müttern, beispielsweise im Kindbett. Daten zur Gesamtsterblichkeit der Erwachsenen im Ländervergleich gab es bisher nur ausschnittsweise. Jetzt hat ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität von Washington die bisher umfangreichste Studie ihrer Art abgeschlossen und mit Hilfe neuer statistischer Methoden das Sterberisiko aller Erwachsenen für 187 Länder ermittelt. Berechnet wurde dabei jeweils die Wahrscheinlichkeit des Sterbens vor dem 60. Lebensjahr für einen heute gerade 15 Jahre alt gewordenen Menschen dieses Landes.
Ungleichheit wächst
Die Studie zeichnete ein in Teilen erschreckendes Bild: Denn es zeigte sich, dass sich die weltweite Ungleichheit in der Mortalität in den letzten Jahren verschärft hat. Ein erwachsener Mann in Swasiland – dem Land mit der höchsten Sterberate – stirbt mit einer neunfach höheren Wahrscheinlichkeit verfrüht an einer Krankheit, durch Gewalt oder andere äußere Faktoren als eine zypriotische Frau. Die Mortalitätsraten im südlichen Afrika liegen damit heute höher als die im armen und vorindustriellen Schweden des Jahres 1751.
„In der Mortalität unter Erwachsenen sehen wir diese gewaltige Kluft zwischen den besten und den schlechtesten“, erklärt Christopher Murray, Leiter des Institute for Health Metrics and Evaluation an der Universität von Washington. „Das ist ganz anders als unsere Beobachtungen bei der Kindessterblichkeit und der Mortalität von Müttern, die sich beide seit 1970 sehr positiv entwickelt haben.“
Mehr Abstand zwischen Frauen und Männern
Das niedrigste Sterberisiko bei Erwachsenen besteht heute für Männer in Island und für Frauen auf Zypern. Den stärksten Absturz in den Sterberaten erlebte Osteuropa: Russlands Frauen sanken vom 43. Platz im Jahr 1970 auf den 121. Platz heute. Die Wissenschaftler sehen darin einen der größten Rückschläge im öffentlichen Gesundheitswesen der Neuzeit. Insgesamt entwickeln sich zudem die Sterberaten für Frauen und Männer weltweit auseinander. In den 40 Jahren von 1970 bis 2010 sank die Sterberate für Frauen deutlich stärker als die der Männer, heute trennen beide 27 Prozent.
Verbesserungen in Indien und dem südlichen Afrika
Im Vergleich der Regionen haben sich Südasien und Indien extrem positiv entwickelt, sie wiesen noch 1970 mit die höchsten Sterberaten weltweit auf. Heute ist es immerhin deutlich günstiger für das Überleben, eine indische Frau zu sein als ein Mann in den USA des Jahres 1997. Auch im südlichen Afrika, dessen Bewohner durch Armut und die Aids-Epidemie die niedrigste Lebenserwartung überhaupt haben, sind die Sterberaten seit 2005 stark gesunken. Nach Ansicht der Forscher zeigt dies, dass die Bemühungen zur HIV-Prävention und die Behandlung von Aidskranken mit antiretroviralen Medikamenten Wirkung zeigen.
USA sacken ab
Insgesamt war die Fluktuation aber ziemlich groß, von den Top Ten der Länder mit den niedrigsten Sterberaten konnten sich nur Norwegen, Schweden und die Niederlande halten. Die USA sind in den letzen 20 Jahren hinter fast alle westeuropäischen Länder und sogar hinter Chile, Tunesien oder Albanien zurückgefallen. Nach Meinung der Wissenschaftler könnten hierfür auch der steigende Wohlstand und damit die stärkere Verbreitung von Risikofaktoren wie Übergewicht, hohem Blutdruck oder Rauchen eine Rolle spielen.
„Wir waren bemerkenswert ignorant gegenüber der Mortalität von Erwachsenen”, erklärt Alan Lopez von der Universität von Queensland, einer der Koautoren der Studie. „Wir müssen heute die gleiche Leidenschaft, mit der wir Kinder am Leben erhalten wollen, auch gegenüber jungen Erwachsenen aufbringen.“
(University of Washington, 07.05.2010 – NPO)