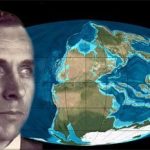Das Erdbeben vom März 2011 vor Japan wurde durch einen besonders großen Versatz im Untergrund ausgelöst. Warum, zeigen jetzt Bohrungen am Epizentrum: Eine ungewöhnlich dünne und schlüpfrige Grenzschicht ermöglichte den enormen Rutsch der beiden hier aufeinandertreffenden Kontinentalplatten. Solche Bedingungen könnten auch anderswo anzeigen, wo besonder schwere Beben drohen, so die Forscher im Fachmagazin „Science“.
Japan am 11. März 2011: Die Erde beginnt zu zittern – grundsätzlich nichts Ungewöhnliches im von Erdbeben geplagten Inselreich. Doch was sich nun entwickelt, sprengt alle Maßstäbe: Das sogenannte Tōhoku-Erdbeben erreichte eine Stärke von neun auf der Magnituden-Skala und war damit das stärkste jemals gemessene Erdbeben in Japan. Die Erschütterungen brachten zahllose Gebäude zum Einsturz – doch nicht nur das: Anschließend rollte auch noch ein Tsunami über die Trümmerlandschaft hinweg. Die Folgen: Über 16.000 Todesopfer und die Nuklearkatastrophe von Fukushima.
Ein besonders großer Ruck
Für die Erdbeben in Japan ist eine sogenannten Subduktionszone verantwortlich: Hier schiebt sich die Pazifische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Zentimetern pro Jahr unter die Philippinische und bildet den Japangraben. Es handelt sich dabei nicht um ein gleichmäßiges Geleiten, sondern es bauen sich Spannungen auf, die sich in Form von Erdbeben lösen. Die Platten ruckeln sich gleichsam vorwärts.
Wie groß ein jeweiliger Ruck ist, hängt dabei von der aufgebauten Spannung und dem Material ab, dass sich der Bewegung entgegen stemmt. Im Fall des Bebens von 2011 war die Verwerfung gewaltig: 30 bis 50 Meter bewegte sich der Erdboden. Das verursachte die verheerende Welle, die nach dem Erdebenen über die Küste Japans hereinbrach.
Um herauszufinden, welche geologischen Besonderheiten für das Ausmaß der Verwerfung verantwortlich gewesen waren, hat ein internationales Forscherteam das „Japan Trench Fast Drilling Projekt“ ins Leben gerufen. Die Geologen trieben von einem Bohrschiff aus drei Löcher ins Tiefengestein des Japangrabens, um das Material der Bruchzone des Erdbebens von 2011 untersuchen zu können. Die Ergebnisse haben die Forscher nun im Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht.
Grenzschicht extrem dünn und feinkörnig
Sie fanden heraus, dass die Grenzschicht der beiden Kontinentalplatten im Bereich des Epizentrums extrem dünn ist: nur etwa fünf Meter. „Unserer Kenntnis nach ist das die dünnste Plattengrenze auf der Erde“, sagt Christie Rowe von der McGill University in Montreal. Beispielsweise sei die entsprechende Schicht im Fall der kalifornischen San-Andreas-Verwerfung mehrere Kilometer dick.
Die Wissenschaftler entdeckten auch Hinweise darauf, dass es bei der Verschiebung im Rahmen des Erdbebens nur zu vergleichsweise wenig Reibungs gekommen ist: Einmal in Bewegung, rutschte es deshalb heftig. Das ergaben Analysen, die Rückschlüsse auf die Wärmeerzeugung zuließen, die bei der Reibung während der Verschiebung entstanden ist.
Schlüpfrig wie Schnee unter den Skiern
Die Ursache dafür zeigte sich bei der Analyse des Materials der dünnen Trennschicht: Es besteht aus einem extrem feinen Sediment. „Es ist der schlüpfrigste Ton, den man sich nur vorstellen kann“, sagt Rowe. Wenn man ihn zwischen den Fingern verreibt, fühlt er sich an wie ein Schmiermittel. Deshalb gab es bei der Bewegung im Rahmen des Erdbebens sehr wenig Reibungswiderstand und die gesamte Spannung konnte sich auf einen Schlag entladen.
Robert Harris, einer der beteiligten Forscher von der Oregon State University, vergleicht den Effekt mit dem Gleiten von Langlaufskiern auf Schnee: „Im Ruhezustand kleben die Ski ein wenig am Schnee und es braucht eine gewisse Kraft, um sie in Bewegung zu setzen. Dann entsteht allerdings Wärme und bei der anschließenden Gleitbewegung entsteht weniger Widerstand“, erklärt der Geologe.
Den Forschern zufolge könnte es auch an anderen Plattengrenzen ähnliche geologische Besonderheiten geben wie im Japangraben und damit ein hohes Risiko für starke Beben beziehungsweise Tsunamis. „Die Suche nach solchem schlüpfrigen Ton könnte uns die Möglichkeit eröffnen, vorherzusagen, wo die Katastrophen drohen“, sagt Casey Moore, einer der beteiligten Wissenschaftler von der University of California in Santa Cruz. (Science, 2013; doi: 10.1126/science.1243719)
(Science, 06.12.2013 – MVI)