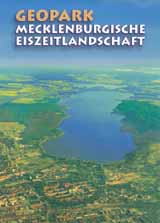Flaches Land ist im Nationalen GeoPark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft nicht zu finden. Wenn auch einige tausend Meter mächtige Gletscher während der Eiszeiten wie ein Hobel über Norddeutschland zogen, so hinterließen sie dennoch keine eingeebnete Fläche. Zwischen zusammen geschobenem oder sedimentiertem Gletscherschutt einerseits und ausgehobelten oder ausgespülten Vertiefungen andererseits ist eine formenreiche Landschaft entstanden. Die hügelige Jungmoränenlandschaft kann mit über hundert Meter hohen Erhebungen und über dreißig Meter tiefen Seen aufwarten.
Seenreichtum und ein kleines Meer
Der Seenreichtum ist für Mecklenburg sprichwörtlich. Manch einer hat im Land der tausend Seen bereits eine Schifffahrt durch die Müritz unternommen, war im Tollensesee tauchen oder hat in einem der vielen anderen Seen gepaddelt. Gebildet hat sich die Mecklenburgische Seenplatte in Hohlformen der letzten Eiszeit. Dabei ist die Entstehungsgeschichte der einzelnen Seen durchaus unterschiedlich. Gletscherzungen schürften Becken aus. In Tunneln unter dem Inlandeis oder vor dem Eisrand abfließende Schmelzwässer spülten Abflussrinnen aus. Inseln von Toteis wurden von Sediment überdeckt und tauten zu einem späteren Zeitpunkt ab.
Auch die Kombination unterschiedlich entstandener Hohlformen in einem See ist möglich. So ist die Müritz ein Kombinationssee aus Rinnen und Toteislöchern. Mit einer Fläche von 117 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 33 Metern ist sie auch der zweitgrößte Binnensee Deutschlands. Das kleine Meer, wie die Müritz in der Übersetzung des ursprünglich slawischen Namens heißt, liegt im Bereich der älteren Grundmoräne des Brandenburger Stadiums der Weichseleiszeit vor 25.000 Jahren.
Die Entstehungsgeschichte einzelner Seen wird aufgrund neuer Erkenntnisse auch durchaus einmal neu geschrieben. So wurde der Tollensesee bei Neubrandenburg bis vor kurzem für ein Gletscherzungenbecken gehalten. Neuere Untersuchungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um ein Tunneltal handelt. Die Schmelzwässer standen also auch im Bereich des Eisrandes unter der mehrere hundert Meter mächtigen Eisdecke noch unter sehr starkem Druck. In Richtung Eisrand suchte dieser Druck einen Ausgleich und wusch dabei den Untergrund aus.