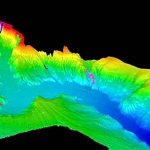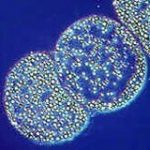„Auf den Meeren und vor allem auch entlang der Küsten nehmen wir Veränderungen lokalen, regionalen und globalen Ausmaßes wahr. Diese sind immer häufiger so komplex, dass wir zum Lösen fachspezifischer Fragen oft einen breiteren Zusammenhang benötigen“, führt der Meeresgeologe aus. „Hier setzt die Graduiertenschule an, in dem sie ihren Doktoranden das Handwerkszeug mitgibt, ihr Expertenwissen in einem breiteren natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Zusammenhang einzusetzen.“
Off-shore Windkraftanlagen im Visier
{2r}
Ein Bereich, in dem eine große Vielzahl von Disziplinen zusammenarbeiten muss, damit es funktioniert, sind Off-shore Windkraftanlagen. Eine Auswahl der Fragen, die beantwortet werden müssen zeigt dies. Wo ist genügend Wind? Wo trägt der Boden langfristig? Wie kommt der Strom an Land? Wie reagieren Fische und Vögel darauf? Wie stark wird die Fischerei beeinträchtigt? Wie akzeptieren Sportsegler die Einschränkung ihres Reviers? Wie reagieren Touristen auf die weißen Windmühlen? Wer entscheidet über die Lage der Windparks und der dazugehörigen Seekabel? Und nicht zuletzt: Sind die Menschen überhaupt bereit, für diesen Strom eventuell mehr zu bezahlen, als für Atomstrom?
Was sind Graduiertenschulen?
Graduiertenschulen schaffen Strukturen, die hervorragende Bedingungen für Doktoranden bieten, damit diese im Rahmen ihrer Doktorarbeit zu exzellenten Wissenschaftlern werden. Dazu gehören neben einem breitem Themenspektrum, die Förderung eigener Projekte, finanzielle Unterstützung bei der Teilnahme an internationalen Tagungen, eine gute Betreuung, ständiger Austausch und Unterstützung durch ein Management, das sich mit allen Belangen der Graduiertenschule auseinandersetzt.
Das Geld für die Doktoranden soll größtenteils aus Drittmitteln kommen. Die eine Million Euro, die aus der Exzellenzinitiative für fünf Jahre nach Bremen fließen, sollen die Rahmenbedingungen optimal gestalten. Dazu gehören in Bremen auch bis zu 200 Euro im Monat für Kinderbetreuung oder ein Englischkurs, damit die Teilnehmer dem umfangreichen, und wohlstrukturierten, englischsprachigen Kursen auch folgen können. Neben ein- und weiterführenden Kursen in den vier Hauptthemen der Graduiertenschule – Ozeane und Klima, Prozesse der Küstenzone, Marine Ökologie und Biogeochemie und Herausforderungen für die Gesellschaft – gibt es zum Beispiel auch Kurse über Themen wie Projektmanagement, Moderation oder Öffentlichkeitsarbeit.
Starke Partner in und um Bremen
Die Universität Bremen bietet für diesen Ansatz beste Möglichkeiten. Neben den starken Meereswissenschaften mit dem meereswissenschaftlich geprägten Fachbereich Geowissenschaften gibt es hier das DFG-Forschungszentrum Ozeanränder, das Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, das Zentrum für Marine Tropenökologie und nahebei in Bremerhaven das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meereswissenschaften. Dort ist auch das Deutsche Schiffahrtsmuseum beheimatet. Das Museum bringt gemeinsam mit dem Fachbereich Rechtswissenschaften und dem Forschungszentrum Nachhaltigkeit Artec an der Universität Bremen die gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenzen ein. Der Pool der hier tätigen Wissenschaftler stellt zunächst das Lehrpersonal und auch die Betreuer der Doktoranden.
Die Pläne von Dierk Hebbeln und seinen Mitstreitern reichen jedoch weiter: „Im Moment arbeiten wir mit Juristen, Soziologen und Historikern zusammen, aber wir können uns noch viel mehr vorstellen.“ Weitere Bereiche der Universität sind eingeladen sich zu beteiligen, als Beispiel nennt er Logistiker, die sich zum Beispiel mit der Schienenanbindung des Jade-Weser-Ports beschäftigen könnten. „Doch auch jetzt schon haben wir die besten Vorraussetzungen, wirklich exzellente Ausbildung anzubieten. Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Doktoranden“, so Dierk Hebbeln.
(Kirsten Achenbach, DFG-Forschungszentrum Ozeanränder, 08.11.2006 – AHE)
8. November 2006