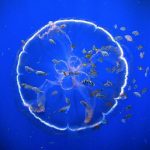Die aus dem westlichen Atlantik eingewanderte Rippenqualle könnte das gesamte planktische Ökosystem der Ostsee stark verändern: Untersuchungen von Fischereibiologen haben zum ersten Mal gezeigt, dass es in dem wichtigsten Laichgebiet des Dorsches zu einer zeitlichen Überlappung von Mnemiopsis leidyi und Dorscheiern kommt. Um genauer einschätzen zu können, inwieweit die Rippenqualle den Fischbestand beeinträchtigt, sind jedoch weitere Forschungsarbeiten erforderlich, so die Forscher in der Fachzeitschrift „Marine Ecology Progress Series“.
{1r}
Seit Jahren ist der Ostseedorsch aufgrund von Überfischung und Umweltbelastungen in seinem Bestand gefährdet. Mit der Entdeckung der fremden Rippenqualle durch Meeresbiologen im November 2006, kam eine weitere potentielle Gefährdung dieser für den kommerziellen Fischfang wichtigen Art hinzu. Die Rippenqualle, die eigentlich an der nordamerikanischen Ostküste beheimatet ist, gelangte vermutlich durch Ballastwassereinträge von Schiffen in europäische Gewässer.
„Blinde Passagiere“
Organismen, die als „blinde Passagiere“ eingeschleppt werden, führen oft zu erheblichen Veränderungen der betroffenen Ökosysteme. Ende der 1980er Jahre war dies beispielsweise nach dem Auftreten von Mnemiopsis leidyi im Schwarzen Meer zu beobachten. Die Rippenqualle hat eine für Fisch bedeutende Ernährungsgewohnheit: sie ernährt sich von Zooplankton, mikroskopisch kleine Lebewesen im Ozean. Damit ist der fremde Gast einerseits Nahrungskonkurrent der Fische, andererseits ernährt sich die Rippenqualle auch von den Fischlarven und -eiern und kann damit zur Dezimierung der Bestände beitragen. Ob die fremde Rippenqualle als so genannter Bruträuber eine potentielle Bedrohung der Fischbestände in der Ostsee darstellt, war unter anderem Ziel der Untersuchungen von mehreren Expeditionen mit dem Forschungsschiff „Alkor“ im Jahr 2007.