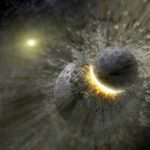Wissenschaftler haben Aminosäuren in einem Meteoriten nachgewiesen, die es eigentlich nicht geben dürfte. Denn der Asteroid 2008 TC3 wurde kurz vor seinem Absturz bei einer gewaltigen Kollision auf über 1.000 Grad erhitzt – alle organischen Moleküle müssten daher vernichtet worden sein. Wie aber bildeten sich dann die jetzt entdeckten Bausteine des Lebens? Die Nachweisdaten und eine Hypothese dazu stellen die Forscher jetzt in der Fachzeitschrift „Meteoritics and Planetary Science“ vor.
Aminosäuren, die Grundbausteine der Proteine, gelten als wichtige Voraussetzung für die Entstehung des Lebens auf der Erde. Einer Theorie nach gelangten die ersten Aminosäuren möglicherweise durch Meteoriteneinschläge auf die frühe Erde. Dafür spricht, dass inzwischen auch im Weltraum Aminosäuren entdeckt worden sind, unter anderem in Proben des Kometen Wild-2, die von der Stardust-Mission der NASA zurückgebracht worden waren und in einigen kohlenstoffreichen Meteoriten.
Kollision im All
Jetzt haben Forscher der NASA und der Scripps Institution of Oceanography an der Universität von Kalifornien in San Diego Aminosäuren auch in einer Meteoritenprobe entdeckt, die eigentlich absolut keine mehr enthalten dürfte. Im Oktober 2008 stürzten Fragmente des Asteroiden 2008 TC3 über der Wüste des Nordsudan ab. Der Asteroid war nicht nur der erste, der schon vor seinem Absturz intensiv beobachtet wurde, er erlebte auch kurz zuvor eine extrem heftige Kollision mit einem anderen Himmelskörper. Dabei wurden Asteroid und „Gegner“ extrem stark erhitzt – genügend, um beide quasi zu sterilisieren und alle organischen Moleküle zu zersetzen.
19 verschiedene Aminosäuren in Probe
Dennoch erklärten sich die NASA und Scripps-Forscher bereit, Proben des Meteoriten im Labor auf eventuelle Aminosäurereste hin zu analysieren. Zur großen Überraschung der Wissenschaftler entdeckten die extrem sensiblen Instrumente beider Labore in den Meteoritenproben tatsächlich winzige Mengen von gleich 19 verschiedenen Aminosäuren. Die Konzentrationen bewegten sich zwischen 0,5 und 149 parts per billion (ppb – Teilchen pro einer Milliarde).