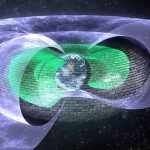Doppelte Klimawirkung: Die zunehmenden Brände in der arktischen Taiga und Tundra schaden auch der Ozonschicht und tragen zum arktischen Ozonabbau bei, wie Messungen nahelegen. Demnach kann der Rauch solcher Brände bis an die Grenze der Stratosphäre aufsteigen. Im Winter 2019/2020 stieg die Aerosoldichte in dieser Höhe durch sibirische Waldbrände um das Zehnfache an. Die Schwebteilchen wiederum können ozonabbauende Reaktionen in der Ozonschicht fördern.
Lange Zeit gab es nur über dem Südpol ein echtes Ozonloch. Doch in den letzten Jahren kommt es auch über der Arktis immer häufiger zu einem starken Schwund des stratosphärischen Ozons. 2011, 2016 und im Frühjahr 2020 sanken die Ozondichten so stark ab, dass über der Nordpolarregion ein Ozonloch auftat. Als Ursache gelten primär die durch den Klimawandel veränderten Luftströmungen in der Arktis, die den ringförmigen Polarwirbel stärken und die Stratosphäre extrem auskühlen lassen. Das wiederum begünstigt den Ozonabbau.

Laserblick in die arktische Atmosphäre
Doch es gibt offenbar noch einen zweiten Faktor, der den arktischen Ozonschwund vorantreibt: der Rauch der zunehmenden Taiga- und Tundrabrände in der Arktis. Durch die Erwärmung und die zurückgehende Niederschläge kommt es im Nordpolargebiet immer häufiger zu ausgedehnten und teilweise selbst den Winter überdauernden Bränden. Vor allem in Sibirien erreichen diese Feuer in den letzten Jahren immer wieder Rekordausmaße.
Welche Folgen dies für die arktische Ozonschicht hat, haben nun Kevin Ohneiser vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) und seine Kollegen herausgefunden. Im Rahmen der internationalen MOSAiC-Expedition hatten sie von September 2019 bis Mai 2020 regelmäßig die Atmosphärenzusammensetzung über der zentralen Arktis mittels LIDAR untersucht. Diese Lasermessung verrät unter anderem, wie viele Aerosole sich in der Luftsäule befinden. Ergänzt wurde dies durch Satellitendaten sowie LIDAR-Messungen auf Spitzbergen.