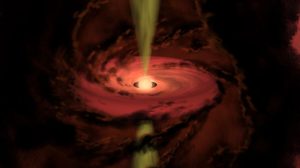Überraschende Entdeckung: Der nur 25 Lichtjahre entfernte Stern Vega hat offenbar keine größeren Planeten – und eine verblüffend gleichmäßige, glatte Staubscheibe, wie neue Beobachtungen des Hubble- und des James-Webb-Teleskops enthüllen. Damit unterscheidet sich dieser berühmte und astronomisch wichtige Stern auf unerwartete Weise von anderen, sehr ähnlichen Sternen wie dem gleichnahen Fomalhaut, wie Astronomen berichten. Aber warum?
Der Stern Vega (deutsch auch Wega) ist nach Sirius der zweithellste Stern am Himmel der Nordhalbkugel und schon seit Jahrtausenden bekannt. Bis heute ist dieser massereiche, bläuliche Stern einer der berühmtesten und wichtigsten Sterne der Astronomie: Seine Vermessung bestätigte einst das heliozentrische Weltbild und sein Licht dient als Referenz für die astronomische Helligkeitsskala. Auch in der Science-Fiction spielt die Vega eine prominente Rolle als Heimat außerirdischer Zivilisationen, als Ziel von interstellaren Raummissionen oder als Ziel eines Wurmlochtransports im Buch und Film „Contact“.

Erster hochauflösender Blick auf Vegas Staubscheibe
Doch trotz dieser Berühmtheit des nahen Stern ist eine Frage ungeklärt: Hat die Vega Planeten? Im Jahr 1983 entdeckten Astronomen zwar anhand eines Überschusses an Infrarotstrahlung, dass der rund 450 Millionen Jahre alte Stern von einer ausgedehnten warmen Staubscheibe umgeben sein muss – es war der erste Nachweis einer solchen zirkumstellaren Scheibe bei einem Stern. Doch wie diese Staubscheibe beschaffen ist und ob es in ihr Planeten gibt, blieb mangels geeigneter Teleskope offen.
Jetzt schaffen Aufnahmen der Vega mit dem James-Webb-Weltraumteleskop erstmals mehr Klarheit. Kate Su von der University of Arizona und ihre Kollegen haben den Stern und seine Umgebung dafür mit dem im mittleren Infrarot arbeitenden MIRI-Spektrografen des Teleskops untersucht. Dieser ist besonders dafür geeignet, die Verteilung der warmen, rund einen Millimeter großen Staubkörnchen um den Stern zu zeigen. Ergänzend werteten die Astronomen Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops aus, das die Signale kleinerer Partikel einfangen kann.