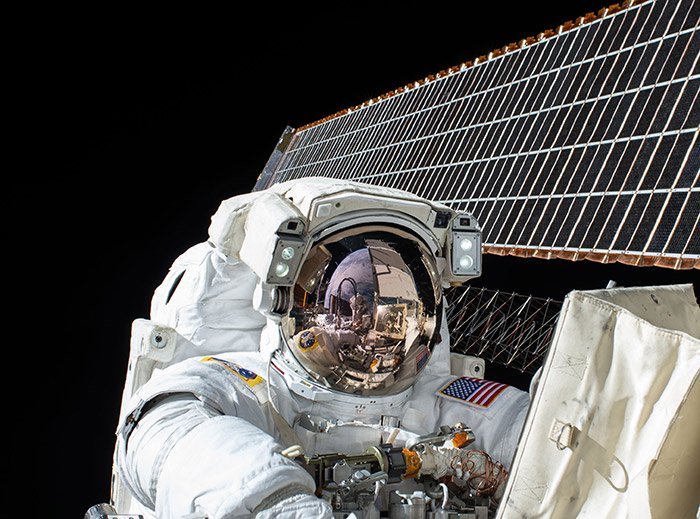Für die Studie lieferten beiden Brüder vor, nach und während des Weltraum-Aufenthalts mehrfach Urin-, Blut- und Speichelproben. Diese analysierten dann zehn verschiedene Forscherteams auf genetische, mikrobiologische und physiologische Parameter hin. Zusätzlich absolvierten beide Astronauten mehrfach im Verlauf des insgesamt 25-Monate dauernden Projekts Tests ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.
Telomere: im All verjüngt?
Jetzt liegen die Ergebnisse vor – und sind teilweise durchaus überraschend. Klar scheint demnach, dass eine lange Weltraummission den Körper und Geist eines Menschen auf vielfache Weise beeinflusst. Die Forscher fanden wie erwartet Veränderungen am Herz-Kreislaufsystem, aber auch der Immunabwehr, dem Bewegungsapparat und den Augen. Erhöhte Entzündungsmarker und veränderte Botenstoffe zeigten ein auch physiologisch erhöhtes Stressniveau an. Bei Scott Kelly war zudem die Genexpression an mehr als 9.000 Genorten verändert, wie die Forscher berichten.
Unerwartet war jedoch eine andere Veränderung am Erbgut: Die Telomere in den Zellen des ISS-Astronauten wurden im Orbit länger – diese Endkappen der Chromosomen wuchsen im Schnitt um 14,5 Prozent. „Das hat uns wirklich überrascht“, sagt Susan Bailey von der Colorado State University. Denn bei Stress und mit dem Alter werden die Telomeren normalerweise eher kürzer. Scott Kellys Chromosomen schienen sich dagegen zu verjüngen.
Merkwürdig auch: Als Scott Kelly zur Erde zurückkehrte, kehrten seine Chromosomenenden zum alten Zustand zurück – aber nicht alle. Ausgerechnet die wenigen Telomere, die im Weltraum geschrumpft waren, blieben auch hinterher verkürzt. Warum, ist bisher unklar.
Kopierfehler im Erbgut
Weniger überraschend, aber klar negativ ist dagegen ein weiterer genetischer Effekt: Während der Raummission machten die Zellen des Astronauten beim Kopieren der DNA deutlich mehr Fehler als normal. Sie bauten Teile der Chromosomen falsch herum oder an der falschen Stelle ein. „Gleichzeitig wurden auch Gene verstärkt abgelesen, die mit Reaktionen auf DNA-Schäden verknüpft sind“, berichten Garrett-Bakelman und ihr Team.
Dies deutet darauf hin, dass der Aufenthalt im Weltraum vermehrte Schäden und Fehler im Erbgut verursacht. Grund dafür ist die erhöhte Strahlenbelastung im Erdorbit, wie die Forscher erklären. Der Astronaut war während des Jahres auf der ISS einer Strahlendosis von 146 Millisievert ausgesetzt – das entspricht 50 Jahren der natürlichen Hintergrundstrahlung auf der Erde.
Bedenklich auch: Selbst nach Rückkehr zur Erde hielten die Kopierfehler bei den Chromosomen noch monatelang an. „Das könnte auf strahlenbedingte Schäden an den Stammzell-Reservoiren der Zellen hindeuten“, so die Wissenschaftler. Langfristig könnten diese Strahlenfolgen das Krebsrisiko für Astronauten deutlich erhöhen.
Geistige Einbußen – nach der Landung
Aber auch am Geist des Astronauten ging die Langzeitmission nicht spurlos vorüber. Während der Zeit auf der ISS nahmen seine kognitiven Leistungen zwar kaum ab, wohl aber nach seiner Rückkehr zur Erde. Die geistige Effizienz des Astronauten sank dabei sogar unter das Niveau vor dem Raumflug. „Diese Defizite in Tempo und Präzision der kognitiven Leistungen blieben bis zu sechs Monate nach der Rückkehr zur Erde erhalten“, berichten Garrett-Bakelman und ihr Team.
Warum sich diese geistigen Defizite erst nach der Landung manifestierten, ist bislang unklar. Für künftige Marsmissionen könnte das aber bedeuten: Auf den Hinflug funktionieren die Astronauten noch recht gut und sind allen Herausforderungen gewachsen. Doch wenn sie dann auf dem Roten Planeten landen, könnten sich Fehler einschleichen. „Das könnte zu einem Problem für die sichere Bewältigung von Raummissionen werden – beispielsweise nach einer Landung auf dem Mars“, sagen die Forscher.
Effekte deutlicher als erwartet
„Die beobachteten Effekte sind damit breitgefächerter und deutlicher als man erwartet hätte – vor allem bei strahlenspezifischen Reaktionen wie der Genom-Instabilität, der hochregulierten Genexpression und den kognitiven Defiziten“, schreibt Markus Löbrich von der TU Darmstadt in einem begleitenden Kommentar. Er betont auch, dass die Astronauten bei einem Marsflug der mehr als fünffachen Strahlendosis ausgesetzt wären. Denn außerhalb des Erdorbits fehlt der Schutzschirm des Erdmagnetfelds.
„Die Details dieser Veränderungen und ihre langfristigen Konsequenzen zu verstehen, wird daher für künftige Unternehmungen wichtig sein“, so Löbrich. „In diesem Punkt ist die Studie von Garrett-Bakelman und ihrem Team mehr als nur ein kleiner Schritt für die Menschheit.“ (Science, 2109; doi: 10.1126/science.aau8650)
Quelle: Science, NASA, Johns Hopkins, Weill Cornell Medicine, Colorado State University, University of California, San Diego
12. April 2019
- Nadja Podbregar