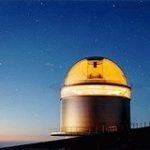Die Astronomie hat ein „Auge im All“ weniger: Das Infrarot-Observatorium Herschel der europäischen Weltraumagentur (ESA) hat seinen Vorrat an flüssigem Helium erschöpft. Da dieses Kühlmittel für die sensiblen Instrumente nötig ist, ist damit der wissenschaftliche Teil der Mission beendet. In den mehr als dreieinhalb Jahren seit seinem Start hat Herschel seinen einzigartigen Blick nicht nur auf ferne Galaxien und Sterne gerichtet. Die Mission hat auch neue und überraschende Erkenntnisse über unser Sonnensystem ermöglicht.
Das Ende kam nicht unerwartet: Denn von Beginn der Mission war klar, dass die mehr als 2.300 Liter flüssiges Helium, die Herschel bei seinem Start im Mai 2009 an Bord hatte, allmählich verdunsten werden. Das Kühlmittel wurde benötigt, um die Instrumente des Infrarot-Teleskops auf nahe den absoluten Nullpunkt abzukühlen. „Doch das Helium verdunstet nach und nach“, erklärt Miriam Rengel, Mitglied des Herschel-Teams vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS). „Geht der Vorrat zu Neige, überhitzen die Instrumente und werden unbrauchbar.“ Denn nur mit Kühlung war es ihnen möglich, winzige Temperaturunterschiede im kalten Universum hochauflösend zu messen und abzubilden.
Mit einem Spiegeldurchmesser von 3,5 Metern war Herschel das größte Infrarot-Teleskop, das jemals im Weltraum betrieben wurde. Zudem ist es das erste Observatorium, das mit seinen drei wissenschaftlichen Instrumenten den kompletten Wellenlängenbereich vom fernen Infrarot bis zum Submillimeter-Bereich abdeckt.
Gasfilamente und Sternengeburten
“Herschel hat uns eine ganz neue Sicht auf das bisher verborgene Universum eröffnet“, sagt Göran Pilbratt von der ESA. „So gab das Teleskop einen Einblick in den Prozess der Sterngeburt und Galaxienbildung und folgte der Spur kosmischen Wassers von Molekülwolken bis zu neugeborenen Sternen und ihren Planetenscheiben.“ Insgesamt mehr als 35.000 wissenschaftliche Beobachtungen und 25.000 Stunden Beobachtungs- und Messdaten hat das Teleskop in seinen rund drei Jahren Laufzeit geliefert.