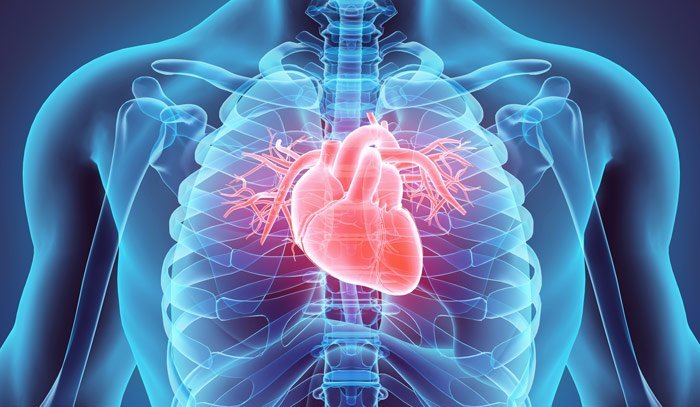Anstatt die Herzen wie bei menschlichen Transplantationen üblich auf Eis zu legen, versorgten sie das Organ während der Implantation über eine spezielle Herz-Lungen-Maschine. Alle fünfzehn Minuten wurde es mit Sauerstoff und einer speziellen Nährlösung versorgt. Durch diese Perfusion gaukelten sie dem Organ in gewisser Hinsicht vor, sich noch im Körper zu befinden – und konnten so eine bessere Konservierung sicherstellen. „Das Herz schlägt dann in den Pavianen von der ersten Sekunde gut und regelmäßig“, berichtet Reichert.
Modifiziertes Erbgut
Der zweite Schlüssel zum Erfolg: Die Wissenschaftler erkannten, dass das Herz im Affenkörper entsprechend der Größe von Schweinen wächst – zu stark für den Brustkorb eines Pavians. Als Folge wird die benachbarte Leber gestaucht und versagt schließlich. Als Gegenmaßnahme verabreichten die Forscher ihren tierischen Probanden blutdrucksenkende Mittel sowie Wirkstoffe, die das Zellwachstum kontrollieren.
Wie in früheren Versuchen auch modifizierte das Team zudem das Erbgut der Spenderschweine: Unter anderem schalteten sie bestimmte Gene bei den Tieren aus und sorgten dafür, dass deren Herzen bestimmte menschliche Proteine exprimieren – zum Beispiel das für die Blutgerinnung wichtige Thrombomodulin und das sogenannte CD46. Diese gentechischen Eingriffe sollten eine akute Abstoßungsreaktion gegen die artfremden Organe verhindern.
Neuer Überlebensrekord
Längin und seine Kollegen verfeinerten ihr Verfahren sukzessive an insgesamt 16 Pavianen, die in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt wurden. Bei der letzten Gruppe mit fünf Affen gelang ihnen schließlich der größte Erfolg: Von den fünf Tieren überlebten vier bei bester Gesundheit mindestens drei Monate lang – eines von ihnen war sogar noch nach sechseinhalb Monaten mit Schweineherz topfit.
„Die Überlebenszeit und die Funktion der Schweineherzen bis zu 195 Tage ist ein Meilenstein und wurde weltweit bislang nicht durch andere Forschergruppen erreicht“, kommentiert der nicht an den Transplantationen beteiligte Ralf Tönjes vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Auch die Studienautoren hoffen, dass ihre Resultate nun den Weg zu einer klinischen Xenotransplantation von Schweineherzen ebnen.
Bald schon klinische Versuche?
Laut den Richtlinien der International Society of Heart Lung Transplantation wären erste klinische Versuche am Menschen grundsätzlich dann zu rechtfertigen, wenn in Experimenten an Pavianen 60 Prozent der Tiere drei Monate überleben und die Versuchsreihe mindestens zehn Tiere umfasst. „Die aktuelle Studie kommt diesen Kriterien bereits sehr nahe“, schreibt Christoph Knosalla vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung in Berlin in einem Kommentar in „Nature“.
„Der erreichte Fortschritt ist so relevant, dass erste klinische Anwendungen von Organen aus genetisch veränderten Schweinen zu erwägen sind. Allerdings sind nach diesen ersten Ergebnissen in bisher kleinen Versuchsgruppen noch eine Reihe weiterer Entwicklungsschritte bis zur klinischen Reife zu machen“, ergänzt Gustav Steinhoff von der Universitätsmedizin Rostock.
Genau das haben die Wissenschaftler nun vor: Sie werden künftig daran arbeiten, die Spenderherzen und das Prozedere der Xenotransplantation weiter zu verbessern – und hoffen auf schnelle Erfolge. Auf die Frage, wann der erste Patient im Rahmen einer klinischen Studie mit einem solchen Herzen behandelt werden könnte, antwortet Reichert: „In drei Jahren sollten wir soweit sein.“ (Nature, 2018; doi: 10.1038/s41586-018-0765-z)
Quelle: Nature Press/ Klinikum der Universität München
6. Dezember 2018
- Daniela Albat