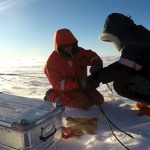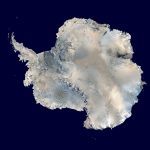Folgenreiche Expedition: Extreme Umweltbedingungen können sich negativ auf unser Gehirn auswirken – das haben Wissenschaftler nun am Beispiel von Polarforschern in der Antarktis gezeigt. Durch deren mehrmonatigen Aufenthalt in Kälte und Abgeschiedenheit schrumpfte demnach ein Teil des Hippocampus. Außerdem enthüllten Tests Einschränkungen beim räumlichen Denken und der selektiven Aufmerksamkeit, wie das Forscherteam berichtet.
Die Antarktis ist der kälteste und lebensfeindlichste Kontinent der Erde. Wer als Wissenschaftler zur deutschen Polarforschungsstation Neumayer III an der Atka-Bucht auf dem 200 Meter dicken Schelfeis aufbricht, muss sich daher auf extreme Bedingungen einstellen: Temperaturen bis zu minus 50 Grad Celsius gehören ebenso dazu wie die nahezu vollständige Dunkelheit im Winter.
Hinzu kommt, dass das Leben auf der Station wenig Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Kontakte zur Außenwelt sind auf ein Minimum reduziert und den Aufenthalt abzubrechen, ist zumindest während der langen Wintermonate keine Option. Evakuierungen im Notfall oder Nachschub von Nahrungsmitteln und Equipment sind nur während des relativ kurzen Sommers möglich.
Am eisigen „Ende der Welt“
Welche Folgen hat dies für das Denkorgan? „Dieses Szenario bietet uns die Gelegenheit zu untersuchen, wie sich das Leben unter extremen Bedingungen auf das menschliche Gehirn auswirkt“, erklärt Alexander Stahn von der Charité-Universitätsmedizin in Berlin. Verändern sich während einer langen Antarktis-Expedition möglicherweise Hirnstruktur und -funktion?
Um dies herauszufinden, begleiteten der Mediziner und seine Kollegen fünf Männer und vier Frauen, die insgesamt 14 Monate auf der Polarforschungsstation verbrachten und davon neun Monate auf sich allein gestellt waren. Vor, während und nach der Mission absolvierten die Probanden eine Reihe von computergestützten Kognitionstests. Diese prüften unter anderem die Konzentrationsfähigkeit, die Gedächtnisleistung und die Reaktionsfähigkeit sowie das räumliche Denken.
Blick ins Denkorgan
Regelmäßige Bluttests sollten darüber hinaus Aufschluss über die Konzentration des sogenannten Wachstumsfaktors BDNF geben – ein Protein, das sich stimulierend auf das Wachstum der Nervenzellen und Synapsen im Gehirn auswirkt. Um Veränderungen im Gehirnvolumen, insbesondere des Hippocampus, feststellen zu können, untersuchten die Wissenschaftler die Studienteilnehmer vor und nach der Mission mithilfe der Magnetresonanztomografie (MRT).
„Dazu nutzten wir eine besonders hochauflösende Methodik, die es ermöglicht, die einzelnen Teilbereiche des Hippocampus exakt zu vermessen“, berichtet Mitautorin Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Alle Tests wurden zusätzlich an einer neunköpfigen Kontrollgruppe durchgeführt.
Verkleinerter Gyrus dentatus
Die Auswertungen enthüllten: Tatsächlich schien sich der Aufenthalt am eisigen „Ende der Welt“ auf das Gehirn der Polarforscher ausgewirkt zu haben. So ergaben die Messungen, dass sich der Gyrus dentatus im Hippocampus nach Expeditionsende im Vergleich zur Kontrollgruppe verkleinert hatte. Dieser Hirnbereich spielt unter anderem für die Festigung von Gedächtnisinhalten und das räumliche Denken eine wichtige Rolle.
Wie die Wissenschaftler berichten, gingen diese Veränderungen mit einer Verringerung des Wachstumsfaktors BDNF einher. Bereits nach dreimonatigem Aufenthalt in der Antarktis war die Konzentration des Wachstumsfaktors demnach unter das vor der Expedition gemessene Niveau gesunken und hatte sich auch eineinhalb Monate nach der Expedition noch nicht normalisiert.
Geringerer Lerneffekt
Diese Veränderungen zeigten sich auch bei den kognitiven Fähigkeiten der Probanden: In den Experimenten zeichneten sich Effekte auf das räumliche Denken sowie die sogenannte selektive Aufmerksamkeit ab – letztere ist nötig, um nicht relevante Informationen auszublenden und sich auf das aktuell Wichtige zu fokussieren.
Während sich Studienteilnehmer nach wiederholter Absolvierung solcher Tests normalerweise darin verbessern, fiel dieser Lerneffekt geringer aus, je stärker das Volumen des Gyrus dentatus abgenommen hatte. Womöglich lässt sich dieser Effekt unter anderem dadurch erklären, dass die Polarforscher auf der Station wenigen Reizen ausgesetzt sind. Selbst bei Ausflügen nach draußen bekommen sie zudem nur Eis und kaum Landmarken zu sehen – Dinge, die diese kognitiven Fähigkeiten trainieren könnten.
Hilft Sport?
Was bedeuten diese Beobachtungen nun? „Angesichts der geringen Anzahl an Probandinnen und Probanden sind die Ergebnisse unserer Studie vorsichtig zu interpretieren. Sie geben aber – wie auch erste Erkenntnisse bei Mäusen – einen wichtigen Hinweis darauf, dass sich extreme Umweltbedingungen negativ auf das Gehirn auswirken können, insbesondere auf die Bildung neuer Nervenzellen im Gyrus dentatus des Hippocampus“, konstatiert Stahn.
Diese Erkenntnisse sind auch mit Hinblick auf den möglichen Aufbau von Mond- oder Marsstationen in der Zukunft interessant. Denn Astronauten wären dort zum Teil ganz ähnlichen Bedingungen ausgesetzt wie die Polarforscher in der Antarktis. In einem nächsten Schritt wollen die Forscher nun untersuchen, ob sich den beobachteten negativen Effekten vorbeugen lässt. Können zum Beispiel regelmäßige Sporteinheiten den Veränderungen des Gehirns entgegenwirken? (New England Journal of Medicine, 2019; doi: 10.1056/NEJMc1904905)
Quelle: Charité/ MPI für Bildungsforschung