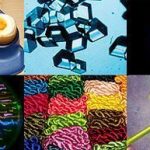Das Team suchte für seine Studie nach kleinen Molekülen, die sowohl an das mutierte Huntingtin binden als auch an ein Protein aus der „Müllabfuhr“ der Zelle. Konkret handelt es sich um das Eiweiß LC3B, das als Bestandteil des Autophagosoms eine wichtige Rolle für die Beseitigung von Krankheitserregern, aber auch fehlgefalteten oder überflüssig gewordenen Proteinen spielt. Die Idee dahinter: Durch die Kopplung an dieses Protein wird das fehlerhafte Huntingtin gewissermaßen für die Autophagie markiert und kann so schneller und besser abgebaut werden.
Weniger mutierte Proteine
Bei der Suche nach potenziellen Kandidaten identifizierten die Wissenschaftler vier geeignete Kopplungsmoleküle. Die 10O5, 8F20 sowie AN1 und AN2 getauften Verbindungen heften sich jeweils an die verlängerte Glutaminreihe des mutierten Huntingtins und an das Protein LC3B an. Aber kann die Konzentration des fehlgefalteten Eiweißes im Gehirn mithilfe dieser Substanzen wirklich reduziert werden?
Versuche mit Neuronen von Mäusen und Hirnzellen, die die Forscher aus Hautzellen menschlicher Patienten erzeugt hatten, offenbarten: Tatsächlich ging die Konzentration mutierter HTT-Proteine durch die Behandlung zurück. Als Folge zeigten die Neuronen weniger Degenerationserscheinungen und auch das Ausmaß des Zelltods wurde reduziert.
Erfolg bei Fliegen und Mäusen
Doch nicht nur das: An Drosophila-Fliegen und Mäusen mit Chorea Huntington wiesen die Wissenschaftler zudem nach, dass der Proteinabbau zu einer Verbesserung der Symptomatik führte. So konnten behandelte Fliegen wieder klettern und überlebten länger als unbehandelte Artgenossen. Mäuse schnitten dank der Therapie in drei Bewegungstests besser ab, wie das Team berichtet.
Das Entscheidende an den nun identifizierten Verbindungen ist, dass sie nur mit der mutierten und nicht mit der gesunden Version des Proteins interagieren. Denn betroffene Patienten besitzen meist nur eine fehlerhafte Genkopie. Die zweite Kopie produziert dagegen ein ganz normal funktionierendes Eiweiß, das wichtige Aufgaben bei der Embryonalentwicklung, aber auch nach der Geburt übernimmt.
Selektiv genug?
Unklar ist bisher allerdings, ob die neu identifizierten Kopplungsmoleküle möglicherweise noch andere Proteine für den Abbau markieren. So stellten die Wissenschaftler fest: Bei behandelten Mäusen veränderte sich das Vorkommen eines kleinen Anteils weiterer Proteine. „Schon geringfügige Veränderungen in der Proteinexpression können zu neurologischen Defiziten führen. Daher ist ein nächster wichtiger Schritt, potenzielle ‚Off-Target‘-Effekte der Verbindungen genauer zu untersuchen“, betont Huda Zoghbi vom Baylor College of Medicine in Houston in einem Kommentar.
Weitere Untersuchungen müssen nun zudem klären, wie erfolgreich eine Langzeit-Therapie ist und ob sich die Ergebnisse auch auf andere Tiere und schließlich den Menschen übertragen lassen. Bestätigt sich der Nutzen, bedeutet das nicht nur für Huntington-Patienten erstmals die Hoffnung auf eine wirkungsvolle Behandlung.
Ansatz auch für andere Leiden
Auch Betroffene anderer neurodegenerativer Erkrankungen könnten von dem Ansatz profitieren, wie die Wissenschaftler erklären. In ersten Experimenten haben sie unter anderem gezeigt, dass einige ihrer Verbindungen gegen mutierte Varianten eines Proteins namens Ataxin-3 wirken. Genmutationen führen auch bei diesem Eiweiß zu einem Zuviel an Glutamin-Resten und verursachen die sogenannte Machado-Joseph-Krankheit. (Nature, 2019; doi: 10.1038/s41586-019-1722-1)
Quelle: Nature Press
31. Oktober 2019
- Daniela Albat