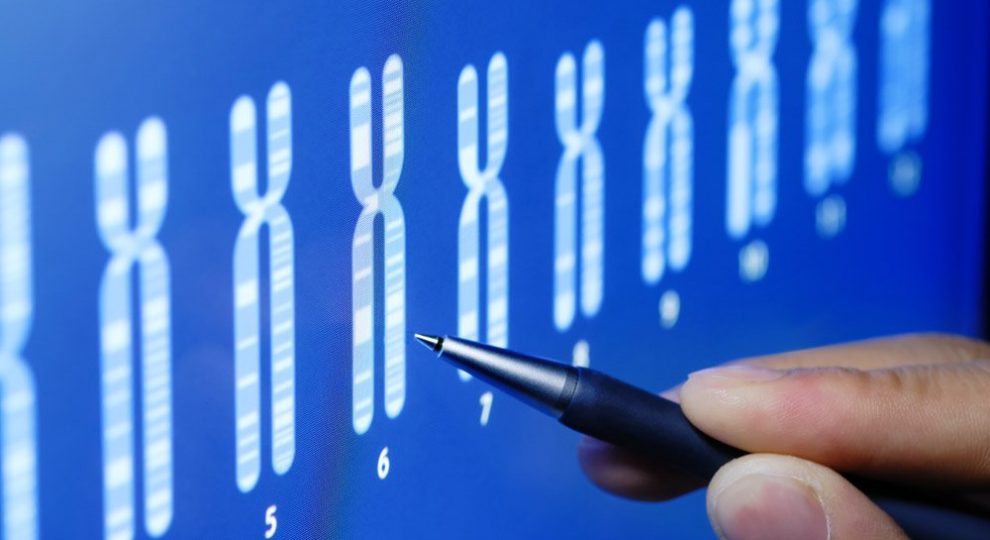Folgenreicher Erbgutdefekt: Menschen mit Down-Syndrom haben oft Probleme mit Gedächtnis und Entscheidungsfindung. Jetzt haben Forscher herausgefunden, welche Regionen auf dem Chromosom 21 dafür verantwortlich sein könnten. Ihre Experimente mit Mäusen legen nahe: Entgegen der gängigen Annahme gehen die kognitiven Symptome nicht auf ein einzelnes Gen oder eine einzelne Gengruppe zurück. Stattdessen scheinen an den unterschiedlichen Defiziten jeweils unterschiedliche Gene und Hirnschaltkreise beteiligt zu sein.
Eines von 800 Kindern wird weltweit mit Down-Syndrom geboren. Dieser auch als Trisomie 21 bezeichnete Erbgutdefekt entsteht durch einen Fehler bei der Zellteilung. Statt wie üblich 23 Chromosomenpaare enthalten betroffene Zellen einen zusätzlichen Träger der Erbinformation: Das gesamte Chromosom 21 ist nicht doppelt, sondern ganz oder in Teilen dreifach vorhanden.
Dies führt sowohl zu körperlichen Beeinträchtigungen als auch zu kognitive Schwächen. Typisch sind dabei zum Beispiel Lern- und Erinnerungsschwierigkeiten. Auch Dinge zu planen oder Entscheidungen zu treffen stellt für Betroffene oftmals eine große Herausforderung dar. Mediziner gehen davon aus, dass für diese geistigen Defizite die Überexpression einzelner Gene des Chromosoms 21 verantwortlich ist. Im Fokus steht dabei unter anderem das DYRK1A-Gen – ein wichtiger Regulator bei der Differenzierung von Nervenzellen.
Gene im Blick
Um die Rolle dieses und weiterer Gene für die kognitiven Einschränkungen von Down-Syndrom-Patienten zu untersuchen, haben Forscher um Pishan Chang vom University College London nun Experimente mit Mäusen durchgeführt. Die Nagetiere verfügen ebenfalls über die Gene des menschlichen Chromosom 21 – sie sind bei ihnen allerdings auf den drei Chromosomen 16, 10 und 17 verteilt.
Für ihre Studie veränderten die Wissenschaftler ihre Versuchsmäuse so, dass die entsprechenden Gengruppen auf einem dieser Chromosomen in dreifacher Ausführung vorhanden waren. Das Ergebnis waren Tiere, die jeweils unter unterschiedlichen Varianten einer Teil-Trisomie litten. Wie würden diese Mäuse in Navigationstests abschneiden, die sowohl ihre Erinnerung als auch ihre Fähigkeit zur Entscheidungsfindung auf die Probe stellten? Und würden sich dabei Auffälligkeiten in der Gehirnaktivität zeigen?
Auffällige Hirnsignale
Die Ergebnisse enthüllten: Mäuse, die eine zusätzliche Kopie der den menschlichen Trisomie-21-Genen entsprechenden DNA-Abschnitte auf Chromosom 10 hatten, zeigten im Test deutliche Erinnerungsdefizite. Außerdem wiesen die Hirnsignale in Teilen ihres Hippocampus Unregelmäßigkeiten auf, wie Elektroenzephalografie-Messungen (EEG) ergaben. Der Hippocampus gilt als eine für Lernen und Gedächtnis zentrale Struktur.
Auch Mäuse mit einem Zuviel an Genen auf Chromosom 16 hatten beim Navigationstest Probleme – allerdings anderer Art als ihre Artgenossen. Wie die Forscher berichten, brauchten diese Tiere im Test länger, um Entscheidungen zu fällen. Eine mögliche Erklärung dafür zeigte sich an den Hirnsignalen: Offenbar war bei betroffenen Nagern die Kommunikation zwischen Hippocampus und präfrontalem Cortex gestört. Letzterer ist unter anderem für Entscheidungen zuständig.
Überraschende Ergebnisse
Interessant auch: Die Auffälligkeiten bei den Mäusen mit verändertem Chromosom 16 waren dem Forscherteam zufolge unabhängig von der Expression des DYRK1A-Gens, das bislang als wesentlich verantwortlich für die geistigen Defizite bei Down-Syndrom galt. Mäuse mit zusätzlichen Gengruppen auf ihrem Chromosom 17 schnitten im Versuch dagegen ähnlich gut ab wie nicht genetisch veränderte Kontrolltiere.
Insgesamt sind diese Ergebnisse eine echte Überraschung, wie Chengs Kollege Matthew Walker erklärt: „Traditionell war bisher die Hypothese verbreitet, dass die intellektuellen Einschränkungen bei Down-Syndrom auf ein einziges oder wenige einzelne Gene zurückzuführen sind. Wir zeigen nun zum ersten Mal, dass stattdessen eine Vielzahl unterschiedlicher Gene an diesen kognitiven Problemen beteiligt zu sein scheint.“
„Wertvolle Einblicke“
Erstmals lassen sich damit verschiedene Symptome wie Erinnerungs- oder Entscheidungsdefizite mit Störungen bestimmter Hirnschaltkreise in Verbindung bringen und vor allem mit spezifischen Regionen des menschlichen Chromosom 21, wie die Wissenschaftler betonen. Nun gelte es herauszufinden, welche Gene genau für die im Experiment beobachteten kognitiven und elektrophysiologischen Besonderheiten zuständig sind.
„Unsere Studie liefert wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter den geistigen Behinderungen von Menschen mit Down-Syndrom. Demnach gehen diese Defizite wahrscheinlich auf diverse genetische und funktionale Anomalien in unterschiedlichen Gehirnregionen zurück“, sagt Chengs Kollegin Elizabeth Fisher. „Das legt nahe, dass auch Therapien mehrere dieser Anomalien anvisieren müssen.“
Immer mehr Betroffene
Die Ursachen hinter dem Phänomen Down-Syndrom und seinen Ausprägungen besser zu verstehen, ist heute wichtiger denn je. Denn die Zahl der Menschen mit Trisomie 21 nimmt kontinuierlich zu. Dies liegt einerseits daran, dass Frauen immer später Kinder bekommen. Das Alter der Mutter gilt als ein entscheidender Risikofaktor für Down-Syndrom.
Andererseits spielt auch die steigende Lebenserwartung Betroffener eine Rolle: Immer mehr Menschen mit Down-Syndrom erreichen dank guter Gesundheitsversorgung und Förderung ein hohes Alter. Schätzungen zufolge leben weltweit inzwischen sechs Millionen Menschen mit diesem Erbgutdefekt – Tendenz steigend, wie die Forscher erklären. (Cell Reports, 2019; doi: 10.1101/644849)
Quelle: University College London