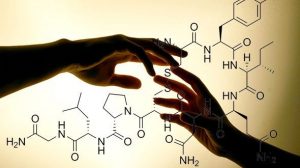Unsere Gene bestimmen mit, wie sensibel wir für die Gefühle anderer Menschen sind. Immerhin zehn Prozent unserer Empathie-Fähigkeit wird demnach von unserem Erbgut beeinflusst, wie die bisher größte DNA-Studie dazu enthüllt. Über welche Mechanismen dies jedoch geschieht und warum, ist noch unklar. Interessant auch: Die Studie bestätigt, dass Frauen im Schnitt empathischer sind als Männer – und das daran nicht die Gene schuld sind.
Ob Trauer, Freude oder Schmerz: Sich in die Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen und entsprechend zu reagieren, ist ein wichtiger Baustein unseres sozialen Miteinanders. Das zeigt sich vor allem dann, wenn diese Fähigkeit zur Empathie eingeschränkt ist – beispielsweise bei Menschen mit Autismus. Umgekehrt gibt es auch Menschen, die besonders sensibel auf die Emotionen anderer reagieren.
DNA-Vergleich von 46.000 Menschen
Doch was bestimmt, wie empathisch wir sind? Gängiger Annahme nach wird dies vor allem von unseren Erfahrungen und vielleicht sogar vorgeburtlichen Einflüssen geprägt. Aber spielen vielleicht auch genetische Faktoren eine Rolle? Um das herauszufinden, haben Varun Warrier von der University of Cambridge und seine Kollegen Gendaten von 46.000 Menschen ausgewertet.
Alle Teilnehmer dieser bisher größten Studie dieser Art absolvierten einen standardisierten Online-Test, über den die Forscher den Grad ihrer Empathie ermitteln konnten. Eine Speichelprobe lieferte die DNA der Probanden, die dann bei der Firma 23andMe analysiert wurde.
Ein Zehntel kommt von den Genen
Das Ergebnis: Die Gene spielen tatsächlich eine Rolle für unsere Fähigkeit zur Empathie. Denn wie die Analysen ergaben, häuften sich bestimmte Genvarianten bei Menschen mit besonders hoher Empathie, andere kamen bei weniger empathischen Teilnehmern vor. Immerhin rund ein Zehntel der natürlichen Empathie-Bandbreite geht damit wahrscheinlich auf genetische Faktoren zurück, berichten die Forscher.
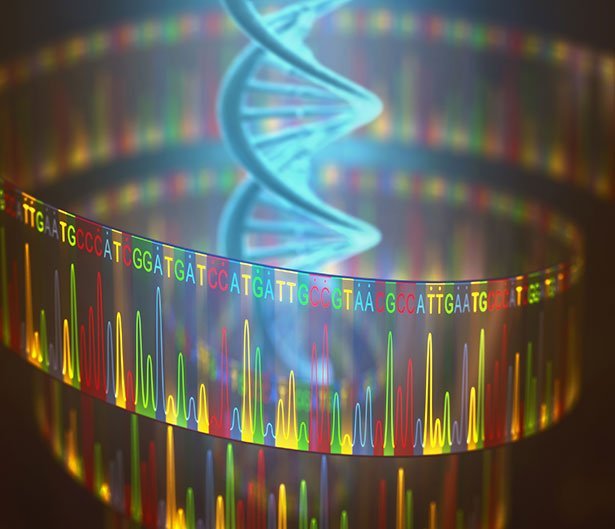
„Das eröffnet uns eine faszinierende neue Sicht der genetischen Einflüsse auf die Empathie“, sagt Koautor Thomas Bourgeron von der Universität Paris Diderot. Doch welche biologischen Mechanismen und Signalwege mit den verschiedenen Genvarianten verknüpft sind, ist größtenteils unbekannt. „Jedes dieser Gene spielt nur eine kleine Rolle und das macht es schwer, sie zu identifizieren“, erklärt Bourgeron.
Frauen sind empathischer als Männer
Interessant auch: Die Online-Tests bestätigten, dass Frauen im Schnitt tatsächlich empathischer sind als Männer. Das allerdings scheint keine genetischen Gründe zu haben, wie die Wissenschaftler erklären. Denn bei ihren DNA-Vergleichen konnte sie keine signifikanten Unterschiede in der Verteilung der Empathie-Genvarianten zwischen Männer und Frauen feststellen.
Nach Ansicht der Forscher müssen diese Geschlechtsunterschiede in der Empathie daher auf nichtgenetische Faktoren zurückgehen. Möglich wären hormonelle Einflüsse, aber auch eine andere Sozialisation. Denn noch immer heißt es oft: „Jungs weinen nicht“ und Mädchen werden eher dafür belohnt, Mitleid zu zeigen als Jungen. Die Studie ergab zudem, dass Teilnehmer mit besonders vielen Genvarianten für geringe Empathie auch ein höheres Risiko für Autismus besaßen.
Und die restlichen 90 Prozent?
„Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt, um die kleine, aber wichtige Rolle der Genetik für die Empathie zu verstehen“, sagt Warrier. „Aber wir müssen im Kopf behalten, dass nur ein Zehntel der individuellen Unterschiede dabei auf die Gene zurückgehen. Es ist deshalb genauso wichtig, die nichtgenetischen Faktoren zu kennen, die die restlichen 90 Prozent erklären.“
Bisher sind diese Einflüsse aber nur in Teilen bekannt. So scheint die Empathie unter anderem eng mit dem Schmerzempfinden zusammenzuhängen, aber auch mit der Sensibilität für das „Kuschelhormon“ Oxytocin.
Um die Mechanismen hinter der Empathie besser zu verstehen, ist daher noch einiges an Forschung nötig. „Unser nächster Schritt ist es, die aktuellen Ergebnisse mit noch größeren Teilnehmerzahlen zu replizieren“, sagt Bourgeron. „Das könnte helfen, die biologischen Signalwege zu identifizieren, die hinter den individuellen Unterschieden in der Empathie stecken.“ (Translational Psychiatry, 2018; doi: 10.1038/s41398-017-0082-6)
(University of Cambridge, 12.03.2018 – NPO)