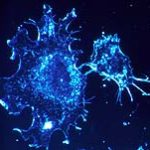Wer an Prostatakrebs erkrankt, merkt davon manchmal zeitlebens nichts: Oft wachsen die Tumoren so langsam, dass sie über viele Jahre keine Beschwerden verursachen. Mit trickreichen Mechanismen sorgt der Körper dafür, dass sich die Krebszellen nur langsam teilen. Bei manchen Patienten sind die Tumoren aber erheblich aggressiver. Wissenschaftler aus Freiburg und Bonn haben nun ein Enzym identifiziert, das dafür verantwortlich sein könnte: Es bewirkt, dass die Zellteilungs-Gene in der Prostata viel häufiger abgelesen werden als normal. Die Ergebnisse erscheinen in der Zeitschrift „Nature“.
{1l}
Die Prostata erneuert sich ständig: Prostatazellen teilen sich, altern und gehen zugrunde. Das alles in fein austariertem Gleichgewicht, so dass die Vorsteherdrüse normalerweise weder wächst noch schrumpft. Anders sieht es aus, wenn Zellen mutieren und dadurch „unsterblich“ werden: Dann gerät das System aus dem Ruder, so dass sich gefährliche Tumoren bilden.
Dazu trägt auch ein Hormon bei, das beim Mann normalerweise für Bartwuchs, Samenproduktion, eine dunkle Stimme und kräftige Muskeln sorgt: Das Testosteron. In der Vorsteherdrüse aktiviert Testosteron unter anderem die Zellteilungs-Gene. „Unter seinem Einfluss können daher aus entarteten Zellen Tumoren entstehen“, erklärt der Bonner Pathologe Professor Dr. Reinhard Büttner. „Daher versucht man, den Körper bei Prostatakrebs dazu zu bringen, weniger Testosteron zu produzieren, und so die Teilung der Krebszellen zu stoppen.“
„Morsestreifen“ in der Zelle
Ohnehin wachsen die Krebszellen meist nur langsam. Dafür sorgt ein ausgeklügelter Mechanismus, der die Teilung-Gene teilweise inaktiviert: Unser Erbgut ähnelt im Prinzip einem langen Morsestreifen, auf dem die komplette Bauanleitung des Menschen steht. Würde man die DNA unserer 46 Chromosomen aneinanderknoten, wäre der resultierende Faden etwa einen Meter lang. In Realität ist die DNA jedoch um winzige kugelförmige Eiweiße gewickelt, die so genannten Histone. Je enger diese „Lockenwickler“ liegen, desto schwieriger wird es für die Zelle, die Informationen auf dem DNA-Faden abzulesen. „Aktive“ Gene sind daher lockerer gepackt; Erbanlagen, die nicht abgelesen werden sollen, hingegen sehr eng aufgewickelt. Dazu gehören auch die „Zellteilungs-Gene“ in der Prostata.
Die Zellen können jedoch steuern, wie dicht das Erbgut gepackt wird – beispielsweise, indem sie an die Histone so genannte „Methylgruppen“ kleben. Diese chemischen Verbindungen wirken wie kleine Magnete: Sie sorgen dafür, dass sich die Histone enger nebeneinander legen – die Packungsdichte steigt, Gene werden seltener abgelesen. Andererseits gibt es Enzyme, die die „Magnete“ wieder entfernen. Ein Beispiel ist das Enzym „LSD1“, das Büttner zusammen mit der Freiburger Arbeitsgruppe um Professor Dr. Roland Schüle unter die Lupe genommen hat.
Je mehr LSD1, desto aggressiver der Krebs
„LSD1 kann die Packungsdichte bestimmter Gene so sehr verringern, dass sie sich sehr leicht ablesen lassen“, fasst Professor Büttner die Ergebnisse zusammen. „Dazu gehören auch die Erbanlagen, die Prostata-Zellen für ihre Teilung benötigen.“ Unter Einfluss von LSD1 vermehren sich die Zellen daher erheblich schneller – eine Tatsache, die auch die Aggressivität bestimmter Prostata-Tumoren zu erklären scheint: „Unsere Untersuchungen zeigen: Je mehr LSD1, desto aggressiver die Krebszellen“, betont Professor Büttner.
Mehr noch: LSD1 kann die Erbanlagen so weit entblößen, dass die Prostata-Zellen gar kein Testosteron mehr benötigen, um sich zu teilen. „Das könnte auch erklären, warum Prostatatumoren auch ohne Testosteron nach einiger Zeit wieder zu wachsen beginnen“, meint der Pathologe. Ziel der Forscher ist es daher, das Enzym auszuschalten und so die Zellteilung zu bremsen. In Zellkulturen ist ihnen das bereits gelungen. Langfristig hoffen sie nun auf Medikamente, die sich auch beim Menschen einsetzen lassen.
Einem anderen Ziel sind sie schon näher: „Bei Erkrankungen wie dem Prostatakrebs ist immer eine der ersten Fragen: Wie aggressiv ist der Tumor?“, erklärt Büttner. „Und zwar nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Arzt, der an dieser Einschätzung sein gesamtes Therapiekonzept ausrichten muss. „Operationen helfen beispielsweise bei aggressivem Prostatakrebs oft nicht, weil die Tumoren bereits über die Prostatakapsel hinaus gewachsen sind oder sogar Metastasen bilden. Stattdessen greifen die Ärzte dann eher zur Strahlentherapie. „Die LSD1-Menge in den Tumorzellen der Prostata ist ein sehr guter Hinweis auf ihre Aggressivität“, sagt Professor Büttner. „Diese Tatsache wollen wir künftig für diagnostische Zwecke nutzen.“
(Universität Bonn, 04.08.2005 – NPO)