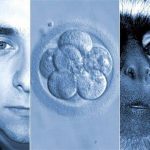Lipid-umhüllte mRNA bringt Genwerkzeug zum Ziel
Für ihre Gentherapie wandelten die Wissenschaftler die Technologie ab, die bei den mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus eingesetzt wird. Diese enthalten eine in einer Lipidhülle verpackte Boten-RNA mit der Bauanleitung für das virale Spike-Protein. Im Falle der Gentherapie enthielt die Injektion die RNA-Bauanleitung für das Base-Editing-Molekül und die Austausch-DNA-Base. Damit der Austausch an der richtigen Stelle stattfindet, beinhaltet das Genwerkzeug zudem eine Leitsequenz, die das zielgenaue Andocken ermöglicht.
Die fertige mRNA-Lösung injizierten die Forschenden sowohl Mäusen als auch Langschwanzmakaken mit krankhaft erhöhten Blutfettwerten. Weil die fettumhüllten mRNA-Partikel vorwiegend von der Leber aufgenommen und verarbeitet werden, gelangte das Genwerkzeug direkt dorthin, wo es wirken sollte. Nach einige Wochen kontrollierten Rothgangl und ihre Team bei allen Tieren, ob und wie gut der Basenaustausch in den Leberzellen funktioniert hatte und wie sich dies auf die Blutfettwerte auswirkte.
Basenaustausch senkt LDL-Werte
Das Ergebnis: „Die genetische Veränderung, die wir in Mäusen und Makaken herbeiführten, blockierte PCSK9 erfolgreich“, berichtet Rothgangls Kollege Gerald Schwank. „Bei den Mäusen konnten bis zu zwei Drittel der PCSK9-Gene verändert werden, bei den nicht-menschlichen Primaten rund ein Drittel. In beiden Fällen führte dies zu einer deutlichen Senkung des LDL-Cholesterinspiegels.“
Konkret sanken die LDL-Werte der Mäuse durch diese Behandlung von im Schnitt 1,5 auf 0,46 Millimol pro Liter – das entspricht einer Reduktion auf nur noch ein Drittel. Bei den Makaken sanken die LDL-Cholesterinwerte im Blut trotz einer deutlich geringeren Rate an ersetzten DNA-Basen immerhin um bis zu 19 Prozent.
Kaum Off-Target-Mutationen
Wichtig auch: Wie bei allen Gentherapien besteht auch beim Base-Editing die Gefahr, dass das Genwerkzeug auch unerwünschte Veränderungen im Erbgut verursacht – indem es beispielsweise DNA-Basen auch in Nicht-Zielgenen austauscht. Inwieweit dies der Fall war, haben Rothgangl und ihr Team sowohl bei Mäusen wie Makaken untersucht. Bei den Mäusen zeigte eine Sequenzierung der zehn wahrscheinlichsten Orte für eine Off-Target-Mutation keine signifikanten Unterschiede zum Genom von Kontrolltieren.
Bei den Makaken ergaben ergänzende Tests zudem, dass die Geneditierungen relativ spezifisch auf die Leber beschränkt blieben. „Wir haben festgestellt, dass die Editierungsraten in Muskeln, Gehirn, Hoden, Pankreas, Lunge, Herz oder Niere unter einem Prozent lagen“, berichtet das Team. Nur in der Milz lagen sie mit rund sechs Prozent höher.
Insgesamt sei es aber eher unwahrscheinlich, dass diese Off-Target-Punktmutationen ein Gesundheitsrisiko darstellen: „Im Laufe eines Menschenlebens sammelt allein jede Leberzelle mehr als 1.000 spontane Punktmutationen an“, erklären Rothgangl und ihre Kollegen. Der Großteil dieser Veränderungen einzelner DNA-Basen bleibe aber folgenlos oder werde schnell wieder korrigiert.
Neue Therapie-Perspektive für Patienten
Nach Ansicht der Forschenden demonstrieren diese Versuche damit, dass die Methode des Base-Editing prinzipiell für die Gentherapie geeignet ist. „Unsere Studie zeigt, dass es möglich ist, sehr effizient und genau veränderte Basen in der Leber von nicht-menschlichen Primaten einzubauen“, sagt Schwank. „Damit eröffnet sich eine neue Therapieperspektive für Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie, einer vererbten Form von hohen Cholesterinwerten.“
Dieser neue Ansatz könnte aber auch genutzt werden, um künftig Patienten mit anderen erblichen Stoffwechselerkrankungen wie die Phenylketonurie oder die Tyrosinämie zu behandeln. „Allerdings müssen die Vorteile solcher Therapien immer sorgfältig gegen die noch verbleibenden Risiken abgewogen werden“, betonen die Wissenschaftler. Sie halten es daher für sinnvoll, das Base-Editing zuerst vor allem bei genbedingten Lebererkrankungen einzusetzen, die bisher nur durch eine Organtransplantation kuriert werden können.
Bevor es aber soweit ist, muss das Base-Editing erst noch in weiteren Tierversuchen auf seine Sicherheit und Wirksamkeit hin untersucht werden. (Nature Biotechnology, 2021; doi: 10.1038/s41587-021-00933-4)
Quelle: Universität Zürich
28. Mai 2021
- Nadja Podbregar