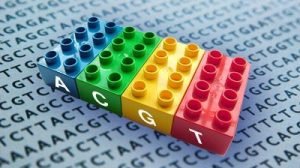Ziel verfehlt: Die Genschere CRISPR/Cas9 gilt als besonders präzises Werkzeug der Molekularbiologie. Doch die Methode ist nicht fehlerfrei, wie eine Studie nun eindrücklich zeigt. Demnach reparierte die Genschere bei Mäusen nicht nur die zuvor anvisierte Mutation – sondern löste zum Teil hunderte weitere Veränderungen aus. Das Brisante dabei: Gängige Algorithmen, die Forscher für die Vorhersage solcher möglichen Nebeneffekte nutzen, hatten die ungeplanten Mutationen nicht prognostiziert.
Wohl kaum ein molekularbiologisches Verfahren hat in den letzten Jahren so viel Furore gemacht wie die Genschere CRISPR/ Cas9. Kein Wunder, schließlich lassen sich mit dem Werkzeug erstmals buchstabengenaue Eingriffe in das Erbgut von fast jedem Organismus vornehmen. Hinzu kommt: Die Methode ist nicht nur so präzise wie keine vor ihr, die Modifikation der DNA wird damit auch besonders leicht und kostengünstig.
Seit der Veröffentlichung der Methode haben Forscher die Genschere immer wieder erfolgreich getestet und weiterentwickelt. So heilten sie mithilfe des Universalwerkzeugs unter anderem Mäuse von der erblich bedingten Muskeldystrophie Duchenne, korrigierten eine Alzheimer-Mutation in menschlichen Zellen und reparierten den Gendefekt der Sichelzellen-Anämie. Dank der vielversprechenden Resultate steht in China nun die erste klinische Studie in den Startlöchern, eine weitere soll kommendes Jahr in den USA beginnen.
Keine fehlerfreie Methode
Trotz der Euphorie funktioniert die Genschere jedoch keineswegs fehlerfrei. Manchmal löst sie Mutationen an Stellen des Genoms aus, die eigentlich unberührt bleiben sollten. Wissenschaftler nutzen deshalb Algorithmen, die vorhersagen, welche Regionen im Erbgut am wahrscheinlichsten von solchen Effekten betroffen sind – und schauen sich diese Bereiche dann genauer an. Kellie Schaefer von der Stanford University und ihre Kollegen warnen nun jedoch: Längst nicht alle ungewollten Veränderungen lassen sich mit diesem Verfahren aufspüren.
„Die Vorhersage-Algorithmen scheinen gut zu funktionieren, wenn CRISPR bei Zellen oder Gewebe in der Petrischale eingesetzt wird“, sagt Mitautor Alexander Bassuk von der University of Iowa. Doch wie sieht es bei lebenden Tieren aus? Um das herauszufinden, analysierten die Forscher das komplette Genom von Mäusen, die für eine vorangegangene Studie mit der Genschere behandelt worden waren.
Hunderte ungeplante Mutationen
Die Analyse zeigte: Wie geplant hatte CRISPR/Cas9 im Erbgut der Tiere erfolgreich die Mutation in einem Gen korrigiert, die zu Blindheit führt. Daneben entdeckte das Team jedoch zahlreiche weitere, offenbar durch die Genschere ausgelöste Veränderungen. Bei zwei Nagern hatte das Werkzeug sage und schreibe mehr als 1.500 Mutationen verursacht, die einzelne Nukleotide betrafen. Hinzu kamen mehr als hundert größere Veränderungen – dabei waren sowohl Genabschnitte gelöscht als auch ergänzt worden.
Das Brisante: Keine einzige dieser DNA-Mutationen hatten gängige Computeralgorithmen zuvor prognostiziert. Für die Wissenschaftler ist damit klar: „Wer keine vollständige Genomsequenzierung durchführt, um unbeabsichtigte Effekte aufzuspüren, könnte wichtige Mutationen übersehen“, sagt Mitautor Stephen Tsang vom Columbia University Medical Center in New York City. „Dabei können selbst Veränderungen auf einem einzigen Nukleotid bereits große Folgen haben.“
Bewusstsein für mögliche Gefahren schaffen
Dennoch wollen Schaefer und ihre Kollegen keine Alarmstimmung verbreiten. Wie sie berichten, konnten sie nicht feststellen, dass den betroffenen Nagern etwas fehlte. „Wir sind noch immer begeistert von CRISPR“, betont Schaefers Kollege Vinit Mahajan. „Aber wir sind Mediziner und wissen, dass jede Therapie potenzielle Nebenwirkungen hat.“ Es sei wichtig, sich solcher möglichen Gefahren auch beim Einsatz der Genschere bewusst zu sein.
„Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse andere Wissenschaftler dazu anregen, bei ihrer CRISPR-Forschung auf die Genomsequenzierung zu setzen und unterschiedliche Versionen des Werkzeugs zu vergleichen, um die sicherste und präziseste Editierungsmethode für ihre Zwecke zu finden“, schließt Tsang. (Nature Methods, 2017; doi: 10.1038/nmeth.4293)
(Columbia University Medical Center, 31.05.2017 – DAL)