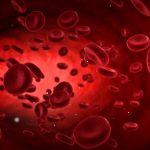Zu enge Familienbande: Forscher haben erstmals geklärt, warum viele Angehörige der Habsburger-Dynastie auffallend vorstehende Unterkiefer und Unterlippen besaßen – die Inzucht war schuld. Denn der Studie zufolge gehen diese Gesichtsmerkmale nicht auf dominante Genvarianten zurück, sondern wahrscheinlich auf rezessive Gene, die nur dann in Erscheinung traten, wenn beide Eltern diese Anlagen trugen und vererbten. Genau dies kommt bei Inzucht überproportional häufig vor, wie die Forscher erklären.
Die Habsburger waren 500 Jahre lang eine der mächtigsten Herrscherdynastien Europas – sie regierten über Spanien, Portugal, Österreich und Ungarn und stellten auch einige römische Kaiser deutscher Nation. Typisch für diesen Familien-Clan war aber nicht nur seine Macht, sondern auch ein typisches Aussehen: In den Gesichtern der meisten Habsburger standen Unterlippe und Unterkiefer auffallend vor, die Spitze der prominenten Hakennase hing leicht herab.

Inzucht oder nur ein dominantes Gen?
Aber warum? Klar scheint, dass die „Habsburger Lippe“ auf eine erbliche Veranlagung zurückgeht. Es muss ein oder mehrere Genvarianten geben, die den Habsburgern diese Kombination aus schwach ausgeprägtem Oberkiefer und vorstehendem Unterkiefer verliehen. Strittig ist aber, ob dies nur ein dominant vererbtes Familienmerkmal ist, oder ob Inzucht durch die vielen Verwandtenehen unter den Habsburgern die Weitergabe dieser Gesichtsmerkmale förderte.
Die Inzucht wäre dann der ausschlaggebende Faktor, wenn die „Habsburger Lippe“ auf rezessive Gene zurückgeht. Denn dann entwickelt sich das Merkmal nur dann, wenn ein Kind von beiden Elternteilen die auslösende Genvariante erbt. Doch ob die typische Gesichtsform der Habsburger auf dominante oder rezessive Gene zurückgeht, war ungeklärt.