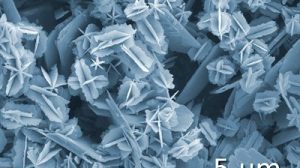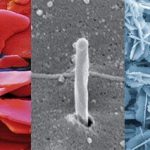Feinstaub schadet sogar ungeborenen Kindern: Sind schwangere Frauen erhöhten Belastungen mit den Mikropartikeln ausgesetzt, steigt ihr Risiko für eine Frühgeburt. Weltweit gingen allein im Jahr 2010 mindestens 2,7 Millionen Frühgeburten auf das Konto der Luftverschmutzung, wie Forscher ermittelt haben. Das entspricht 18 Prozent aller zu früh geborenen Kinder. Ein Großteil dieser Fälle stammt aus Asien.
Dass Feinstaub ungesund ist, ist nicht neu: Studien belegen, dass die Verschmutzung der Luft mit den winzigen Schwebpartikeln das Lungenkrebs-Risiko fördert, Viren aktiviert und sogar dem Gehirn schaden kann. Nach Schätzungen von Forschern gehen weltweit 3,5 Millionen Todesfälle jährlich auf das Konto erhöhter Feinstaub-Belastungen.
Gibt es einen Zusammenhang?
Jetzt haben Christopher Malley von der University of York und seine Kollegen eine weitere negative Folge des Feinstaubs entdeckt. Für ihre Studie sammelten die Forscher Daten zur Feinstaubbelastung von Schwangeren und zum Anteil der Frühgeburten in 183 Ländern und analysierten, ob sich ein Zusammenhang finden lässt.
Weltweit wurden im Jahr 2010 geschätzte 14,9 Millionen Kinder vor der 37. Woche geboren, wie die Forscher berichten. Das entspricht rund elf Prozent der insgesamt 135 Millionen Geburten. Als Risikofaktoren für eine solche Frühgeburt gelten unter anderem ein höheres Alter der Mutter, Mehrlingsgeburten, Krankheiten, Alkoholkonsum, aber auch arme Verhältnisse. Schon länger vermuten Mediziner jedoch, dass auch die Belastung der mütterlichen Gesundheit durch Luftverschmutzung eine Rolle spielen könnte.
2,7 Millionen Frühgeburten zusätzlich
Und tatsächlich: Wie die Forscher ermittelten, könnte eine Belastung mit mehr als zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub allein im Jahr 2010 für 2,7 Millionen zusätzliche Frühgeburten weltweit verantwortlich sein. Das entspricht immerhin rund 18 Prozent aller zu früh geborenen Kinder. Wurden schon Werte von mehr als 4,3 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter als erhöht betrachtet, dann ließen sich sogar 34 Millionen Frühgeburten darauf zurückführen.
„Unsere Studie unterstreicht, dass die Luftverschmutzung nicht nur denjenigen schadet, die die Luft direkt einatmen“, sagt Malley. „Sie kann auch ein Kind im Bauch seiner Mutter schwerwiegend beeinträchtigen.“ Die Belastung schwangerer Frauen durch Feinstaub sei demnach eindeutig ein potenziell bedeutender Risikofaktor für das Risiko einer Frühgeburt.
Drei Viertel der Fälle in Asien
Die Auswertung enthüllte auch deutliche regionalen Unterschiede: Die Regionen, in denen die Luftverschmutzung durch Feinstaub besonders hoch ist, hatten auch den höchsten Anteil an den feinstaubbedingten Frühgeburten. So hatten Südostasien und Südasien zusammen einen Anteil von 75 Prozent. Indien allein macht eine Million der 2,7 Millionen Frühgeburten durch Feinstaub aus, wie die Forscher berichten. In China kommen noch einmal 500.000 hinzu. Ebenfalls deutlich erhöht sind Luftbelastung und Frühgeburtenanteil in Teilen Afrikas.
Neben Dieselabgasen und anderen verkehrsbedingten Emissionen stammt gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern ein großer Teil des Feinstaubs aus Waldbränden, Herdfeuern und Holzheizungen, wie bereits eine frühere Studie ergab. In den an die Sahara angrenzenden Regionen Afrikas kann zudem Wüstenstaub zur Belastung beitragen, wie die Forscher erklären.
„Lebenslange Folgen“
„Um das Feinstaubproblem zu bekämpfen, muss man daher viele verschiedene Quellen kontrollieren“, sagt Koautor Johan Kuylenstierna von der University of York. „In einer Stadt stammt häufig nur die Hälfte der Belastung aus innerstädtischen Quellen, der Rest wird durch den Wind aus anderen Regionen oder sogar Ländern hereingeweht.“
Nach Ansicht der Wissenschaftler unterstreichen ihre Ergebnisse die Notwendigkeit, die Luftverschmutzung durch Feinstaub und andere Schadstoffe zu reduzieren. „Die durch diese Belastung verursachten Frühgeburten tragen nicht nur zu Kindersterblichkeit bei, sie können auch für die Überlebenden lebenslange Folgen nach sich ziehen“, betont Malley. (Environment International, 2017; doi: 10.1016/j.envint.2017.01.023)
(University of York, 20.02.2017 – NPO)