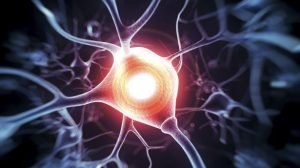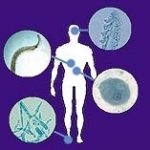Ein Team um Anna-Katharina Ückert von der Universität Konstanz hat nun einen solches Stoffwechselprodukt des Bakteriums Streptomyces venezuelae genauer untersucht. Dieses Bakterium lebt zwar im Boden, verfügt aber möglicherweise über ähnliche Stoffwechselwege und -produkte wie Mikroorganismen in unserem Körper. Die Forschenden versprechen sich aus den Versuchen Hinweise auf die Art des schädlichen Metabolits und seinen Syntheseweg, um dies mit dem menschlichen Mikrobiom vergleichen zu können.
Bakterien-Metabolit im Test
Für ihre Studie isolierte das Team zunächst das Stoffwechselprodukt des Bakteriums in mehreren Reinigungsschritten aus Extrakten von Streptomyces venezuelae und identifizierte es mittels Massenspektrometrie (MS) und Kernspinresonanzspektroskopie (NMR). Für weitere Tests stellten die Forschenden die identifizierte Substanz auch chemisch her.
Anschließend gaben die Wissenschaftler die isolierte sowie synthetisch nachgebaute Substanz im Labor zu menschlichen Dopamin-produzierenden Neuronen, anderen menschlichen Nervenzellen und nicht-neuronalen menschlichen Zellen. Dann beobachteten sie, ob sich die Gehirnzellen verformten oder starben. Zudem testeten Ückert und ihre Kollegen, ob verschiedene natürliche Hemmstoffe und Antioxidantien die Zellschäden verhinderten.
Bakterium produziert den Giftstoff Aerugin
Die Experimente ergaben: Bei dem Metaboliten handelt sich um eine Kombination zweier Stoffe, Aerugin und Aeruginol, zwei 2-Hydroxyphenyl-Thiazolin-Verbindungen, die auch im menschlichen Mikrobiom und in mehreren Krankheitserregern vorkommen. Beide Substanzen zerstörten in der Studie die menschlichen Nervenzellen, insbesondere die Dopamin-produzierenden Neuronen. „Normale“ Zellen blieben dagegen intakt. Da Aerugin toxischer war als Aeruginol, führten die Forschenden die weiteren Tests nur mit diesem Wirkstoff durch.
Ähnlich wie bei Parkinson führte die durch Aerugin ausgelöste Neurodegeneration in den Experimenten zum Absterben der Neuronen. Durch Zugabe bestimmter Antioxidantien und Eisen-Inhibitoren konnte die Wirkung an den getesteten Zelllinien jedoch aufgehoben werden. Daraus schließen die Forschenden, dass Aerugin nur in Kombination mit Eisen für die Zellen giftig ist.
Toxische Wirkung auch in Fadenwürmern nachgewiesen
Aber welche Folgen haben die identifizierten Giftstoffe von Streptomyces venezuelae in einem lebenden Organismus? Um das herauszufinden, setzten die Forschenden auch Fadenwürmer (Caenorhabditis elegans) dem bakteriellen Metaboliten Aerugin aus und untersuchten dessen Wirkung auf das Nervensystem des Modellorganismus.
Tatsächlich zeigten die Würmer nach Kontakt mit dem Bakteriengift Bewegungsschwierigkeiten und spezifische neuronale Muster, die denen von menschlichen Parkinson-Patienten ähnelten. Weitere Experimente mit angefärbten Neuronen ergaben, dass der Giftstoff in Fadenwürmern ebenfalls spezifisch die Dopamin-produzierenden Nervenzellen angriff.
Rückschlüsse auf Auslöser für neurodegenerative Erkrankungen
Die Studie bietet damit eine neue Perspektive auf die Auslöser von Parkinson. „Unsere Forschung stellt eine greifbare Verbindung her zwischen einem spezifischen bakteriellen Metaboliten und Symptomen, die Parkinson ähneln. Es ist ein weiterer Schritt, um zu verstehen, wie unsere Umwelt, bis hin zu den Mikroben um uns herum, den Beginn oder den Verlauf solcher Krankheiten beeinflussen könnte“, sagt Co-Seniorautor Marcel Leist von der Universität Konstanz.
Zugleich stellen sich durch die Entdeckungen neue Fragen: Könnten auch andere mikrobielle Substanzen neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson beeinflussen? Wie interagieren diese Giftstoffe mit unseren Neuronen? Und kann das Wissen um sie und mögliche „Gegengifte“ zu neuen Behandlungen oder Vorbeugemaßnahmen führen? Um dies zu beantworten, sind weitere Forschungen nötig.
„Obwohl unsere Studie erst einen Anfang darstellt, ist sie ein vielversprechender Schritt zur Entschlüsselung der molekularen Ursachen von Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen“, sagt Co-Seniorautor Thomas Böttcher von der Universität Wien. (Environment International, 2023, doi: 10.1016/j.envint.2023.108229)
Quellen: Universität Wien, Universität Konstanz
13. Oktober 2023
- Claudia Krapp