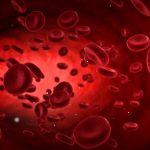Statt Kühlbox: Seit Jahrzehnten werden Spenderlebern für den Transport zum Empfänger heruntergekühlt. Doch nicht alle Organe überstehen diese Prozedur. Eine schonendere Alternative zur Kühlbox könnte ein Verfahren sein, das die Leber in einen Zustand wie im Körper versetzt. Forscher haben diesen Ansatz nun erstmals in einer größeren Studie gegen die herkömmliche Kühlmethode antreten lassen – mit vielversprechenden Ergebnissen.
Für Menschen mit akutem Leberversagen oder einer chronischen Lebererkrankung ist eine Organtransplantation oftmals die letzte Rettung. Doch der Bedarf an Spenderlebern ist groß und die Wartelisten sind lang. Aus diesem Grund müssen Mediziner immer häufiger auf Organe zurückgreifen, die zwar noch funktionieren, aber nicht in einem optimalen Zustand sind – zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen des Spenders. Das Problem: Gerade solche angeschlagenen Spenderlebern überstehen den Transport zum Patienten oftmals nicht.
Die seit Jahrzehnten angewandte Methode, die Organe herunter zu kühlen und in einer Kühlbox zu lagern, erweist sich bei diesen Lebern häufig als fatal. So sind vorbelastete Organe zum Beispiel generell anfälliger für sogenannte Reperfusionsschäden – sie können entstehen, wenn nach längerer Minderdurchblutung wieder frisches Blut durchs Gewebe fließt. Forscher fahnden deshalb schon länger nach besseren Möglichkeiten, Lebertransplantate vom Spender zum Empfänger zu bringen.
Künstlicher Blutkreislauf
Auf der Suche nach Alternativen ist in den letzten Jahren unter anderem die sogenannte normotherme Maschinenperfusion (NMP) in den Fokus gerückt. Dabei wird die Leber in einem Apparat transportiert, der ihr gewissermaßen vorgaukelt, sich noch im Organismus zu befinden. Sie behält Körpertemperatur und wird über Schläuche mit sauerstoffreichem Blut, Nährstoffen sowie speziellen Medikamenten versorgt. Angeschlossen an diesen künstlichen Blutkreislauf funktioniert sie weiterhin wie im Körper und kann zur Not sogar bis zu 24 Stunden am Leben gehalten werden.