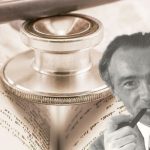Für ihre Experimente mit insgesamt 194 Teilnehmern teilten sie den Probanden entweder die Rolle des Arztes oder des Patienten zu. Die „Patienten“ wurden für die Studie mit schmerzhaften Hitzereizen auf dem Oberarm konfrontiert. Damit die Hitze für sie erträglicher wurde, behandelten die „Ärzte“ sie mit einer von zwei Cremes, die angeblich die Schmerzen lindern sollten. Das Entscheidende: Beide Cremes waren wirkungslos und enthielten exakt dieselben Inhaltsstoffe, die „Ärzte“ aber hielten nur eine von ihnen für ein Placebo. Von der anderen dachten sie, sie sei tatsächlich ein effektives Schmerzmittel.
Geschickt getäuscht
Um dies zu erreichen, hatte Chens Team die Studienteilnehmer zuvor entsprechend konditioniert. So wurde den gespielten Medizinern nicht nur erzählt, wie wirkungsvoll die Creme namens „Thermedol“ angeblich war. Sie durften dies auch am eigenen Leib erfahren, indem sie den gleichen Hitzereizen ausgesetzt wurden wie später ihre „Patienten“. Der Clou: Nach dem Auftragen der Creme erlebten die Probanden tatsächlich eine Linderung. Denn die Forscher reduzierten die Temperatur heimlich von 47 auf 43 Grad Celsius.
„Dies führte zu dem konditionierten Glauben, dass diese Creme tatsächlich ein wirkungsvolles Mittel gegen thermische Schmerzen ist“, erklärt der Mediziner Harald Walach von der Universität Witten-Herdecke in einem begleitenden Kommentar zur Studie. Würde dieser Glauben einen Unterschied für das Behandlungsergebnis machen?
Subtile Zeichen im Gesicht
Tatsächlich zeigte sich: Wendeten die „Ärzte“ die Creme an, die sie für effektiv hielten, wirkte sich dies auch auf das Schmerzempfinden der Behandelten aus. So empfanden die „Patienten“ nach eigenen Angaben weniger Schmerzen und beurteilten die Creme als wirkungsvoller. Diese Unterschiede zeigten sich auch durch körperliche Reaktionen. Zudem hatten sie Einfluss auf die Beurteilung der Therapeuten: Die „Patienten“ nahmen sie in diesen Fällen als empathischer wahr, wie das Team berichtet.
Wie lässt sich dieser Effekt erklären? Womöglich spielen subtile Veränderungen im Gesichtsausdruck eine Rolle, wie die Ergebnisse nahelegten. Während des Experiments gemachte Aufnahmen aus der Perspektive des Patienten enthüllten: Die gespielten Mediziner litten offenbar förmlich mit – dabei verzogen sie das Gesicht stärker, wenn sie die Creme zur Anwendung brachten, die sie für wirkungslos hielten. Ihnen war also anzusehen, dass sie ein Mittel als effektiver bewerteten als das andere.
„Sozial vermittelter Effekt“
„Damit liefern unsere Ergebnisse Belege für einen sozial vermittelten Placebo-Effekt“, erklären die Wissenschaftler. Ob die Hinweise im Gesicht des Arztes das Selbstbewusstsein der Patienten beeinflussen, ihre Erwartungen verändern oder den Arzt empathischer erscheinen lassen, müssen weitere Studien erst noch zeigen. „Wir wissen nun aber, dass subtile Signale vom Arzt gesendet und vom Patienten gelesen werden“, fasst der nicht an der Untersuchung beteiligte Harald Walach zusammen.
Die Forscher vermuten, dass im realen Alltag noch weitere Faktoren für den Einfluss des Arztes eine Rolle spielen. Neben dem Gesichtsausdruck könnte demnach auch das Gesagte oder die Umgebung eine Wirkung haben. Nach Ansicht des Teams ist es daher umso wichtiger, Medizinern schon in der Ausbildung die Bedeutung von Kommunikation, Empathie und Co zu vermitteln.
Insgesamt bestätigen die Beobachtungen, dass die soziale Komponente der Arzt-Patienten-Interaktion niemals unterschätzt werden sollte. „Wir plädieren daher dafür, mehr in die Erforschung der Mechanismen hinter der ältesten und stärksten medizinischen Behandlung überhaupt zu investieren – den Heilern selbst“, so das Fazit der Wissenschaftler. (Nature Human Behaviour, 2019; doi: 10.1038/s41562-019-0749-5)
Quelle: Nature Press
22. Oktober 2019
- Daniela Albat