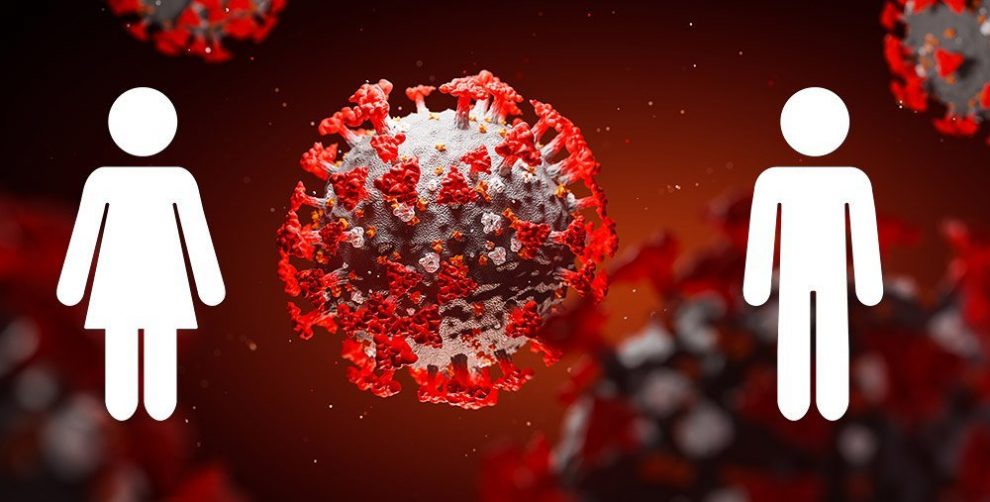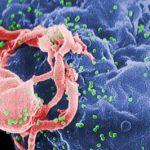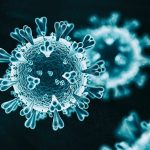Ähnliches geht auch aus europäischen Corona-Statistiken hervor: Von rund 380.000 in Europa registrierten Covid-19-Fällen sind laut WHO 49 Prozent Männer – also ziemlich genau die Hälfte. Unter den an der Infektion Gestorbenen sind jedoch 63 Prozent Männer.
Liegt es am ungesunderen Lebensstil?
Aber warum trifft es Männer härter? Eine Hypothese wäre, dass Männer gesundheitlich schon vorher in schlechterem Zustand sind und mehr Vorerkrankungen haben. Tatsächlich ist die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und der Anteil der Raucher bei Männern in den meisten Bevölkerungen höher. Doch in der Studie von Yang und Kollegen hatten Patienten beider Geschlechter vergleichbare Vorerkrankungen, wie sie berichten. Männer waren demnach nicht schon vorher in schlechterem Zustand als die Frauen.
Ähnliches berichtet Hua Cai von der University of California in Los Angeles nach Auswertung zweier weiterer Studien aus China. Er hatte untersucht, ob es am Anteil der Raucher liegen könnte – in China rauchen 50 Prozent der Männer aber nur rund fünf Prozent der Frauen. Doch in den Studien waren unter den Covid-19-Fällen nur zwischen einem und zwölf Prozent Raucher und die Unterschiede in der Schwere der Verläufe war nicht signifikant. Das mache es unwahrscheinlich, dass Rauchen die Erklärung für die Geschlechtsunterschiede sei, so Cai.
Oder am Immunsystem?
Was aber ist es dann? Eine mögliche Erklärung sind Unterschiede im Immunsystem. Schon länger ist bekannt, dass Frauen gegenüber Infektionen und auch Impfungen eine stärkere Immunantwort zeigen. Influenza und andere virale Erkrankungen der Atemwege haben deshalb bei Männern oft einen schwereren Verlauf – die „Männergrippe“ ist demnach durchaus real.
Forscher gehen davon aus, dass dieser bessere Schutzeffekt bei Frauen zum Teil auf die Geschlechtshormone zurückgeht. Demnach fördern Östrogen und Co offenbar die durch Antikörper vermittelte Immunantwort auf Viren – aber nur bis zu den Wechseljahren, wie eine 2011 eine Studie ergab.
Außerdem könnte es für Viren auch aus evolutionärer Sicht günstiger sein, wenn sie ihre weiblichen Wirte weniger krank machen: Mütter können die Erreger dann noch an ihre Kinder weitergeben. „Für das Pathogen macht diese zusätzliche Übertragungsroute das Leben von Wirten wertvoller, die den vertikalen Transfer erlauben“, erklären die Londoner Forscher Francisco Ubeda und Vincent Jansen, die dieses Phänomen vor einigen Jahren untersucht haben.
Ist der ACE2-Rezeptor schuld?
Doch es könnte noch eine Erklärung geben: der ACE2-Rezeptor. Dieses Protein bildet die Andockstelle für SARS-CoV-2 und ermöglicht es ihm, in menschliche Zellen einzudringen. Der Rezeptor sitzt auf Zellen der Lunge und der Atemwege und kommt auch in anderen Organen wie dem Herzen, den Nerven, dem Darm oder den Nieren vor. Mediziner vermuten, dass die Zahl dieser Rezeptoren mitbeeinflusst, wie anfällig jemand auf das Virus reagiert.
Und auch in diesem Punkt scheint es Unterschiede zwischen Männer und Frauen zu geben, wie Yang und sein Team berichten. „Es ist gezeigt worden, dass die Konzentrationen von ACE2 im Blut von Männern höher sind als bei Frauen – so wie sie auch bei Diabetikern und Herz-Kreislauf-Patienten höher ist“, berichten sie. Die höhere Zahl von ACE2-Rezeptoren könnte zudem erklären, warum schon bei der SARS-Pandemie mehr Männer starben als Frauen: Auch der damalige Erreger dockte an diesem Rezeptor an.
Weitere Studien nötig
Insgesamt scheint es demnach durchaus plausibel, dass es einen biologischen Grund für die höhere Sterblichkeit von Männern bei Covid-19 gibt. Aber noch sind die Daten zu dünn, um mehr als Vermutungen darüber anzustellen, welche Unterschiede genau dafür verantwortlich sein könnten.
„Es sind mehr klinische Studien und Grundlagenforschung nötig, um die Rolle des Geschlechts und anderer prognostischer Faktoren zu ergründen“, betonen Yang und sein Team. (Frontiers in Public Health, 2020; doi: 10.3389/fpubh.2020.00152; The Lancet Respiratory Medicine, 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30117-X; WHO Weekly surveillance Report)
Quelle: Frontiers, Lancet, Nature, WHO
29. April 2020
- Nadja Podbregar