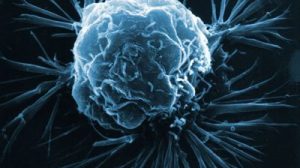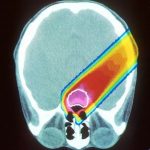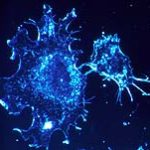Die Experten wollten wissen: Macht das Screening einen entscheidenden Unterschied für Gesundheit und Überleben? Und welches Vorsorgeverfahren ist das beste? Um dies herauszufinden, werteten die Forscher die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema aus. Sie wählten einen Risiko-basierten Ansatz, was bedeutet: sowohl das individuelle Krebsrisiko als auch das Risiko von Schäden durch die Untersuchung und andere Faktoren wurden berücksichtigt. Dabei fragte sich das Team auch, wie groß der Nutzen sein müsste, damit sich die meisten Personen für das Screening entscheiden.
Nicht alle profitieren
Auf Basis ihrer Analysen kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss: Nicht alle Über-50-Jährigen profitieren vom Darmkrebsscreening. „Die Empfehlungen öffentlicher Gesundheitseinrichtungen vermitteln bisher meist die Botschaft, dass jeder die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen sollte – und dass dies nicht zu tun, die Gesundheit gefährdet“, kommentiert Philippe Autier vom International Prevention Research Institute in Lyon im „British Medical Journal“.
Doch genau das ist laut den nun veröffentlichten Ergebnissen von Helsingen und ihren Kollegen fragwürdig. Sie empfehlen: Männer und Frauen, deren persönliches Risiko in den kommenden 15 Jahren Darmkrebs zu entwickeln bei unter drei Prozent liegt, sollte nicht routinemäßig zum Screening geraten werden. Denn der Nutzen ist für diese eher gering Gefährdeten niedrig und überwiegt nicht die potenziellen Nachteile. Demnach würden sich in diesem Fall wohl die meisten Betroffenen gegen das Screening entscheiden. Erst bei einem individuellen Risiko ab drei Prozent halten die Forscher die Vorsorge auf jeden Fall für sinnvoll. Diese Empfehlungen gelten für gesunde Menschen im Alter zwischen 50 und 79 Jahren.
Personalisierter Ansatz
Welche Vorsorgemethode die beste ist – Kotuntersuchung, kleine oder große Darmspiegelung -, dazu kann Helsingens Team auf Grundlage der derzeit zur Verfügung stehenden Daten allerdings keine Empfehlung abgeben. Auch insgesamt gibt es noch viele Unsicherheiten: In welchen zeitlichen Abständen sollen die Untersuchungen durchgeführt werden und ist möglicherweise auch eine Kombination unterschiedlicher Screeningmethoden sinnvoll? All dies müssen den Wissenschaftlern zufolge weitere Forschungsarbeiten klären helfen. „Die evidenzbasierte Datenlage zum Nutzen der Darmkrebsvorsorge ist noch immer lückenhaft“, erklären sie.
Trotzdem fordern die Forscher schon jetzt, weg von der Devise „Screening für alle über 50“ zu kommen. Stattdessen plädieren sie für einen personalisierten Ansatz: Ärzte sollten das individuelle Krebsrisiko ihrer Patienten berücksichtigen und diese im Gespräch ausführlich über den potenziellen Nutzen und mögliche Risiken aufklären.
Mehr Forschung nötig
Den Fokus verstärkt auf das individuelle Risiko zu legen, hätte auch nach Ansicht von Autier eine Reihe von Vorteilen. So könnten Mediziner etwa bei Zeitmangel zunächst mit Risikopatienten über Screening-Optionen sprechen. Entscheiden sich Personen mit niedrigem Risiko gegen die Vorsorgeuntersuchung, könnte zudem die Zahl der Überdiagnosen erheblich sinken, wie der nicht an der Publikation beteiligte Forscher betont.
Klar ist aber auch: Sollen Patienten in Zukunft auf Basis ihres persönlichen Risikos zur Darmkrebsvorsorge beraten werden, müssen Mediziner noch mehr über die entscheidenden Risikofaktoren in Erfahrung bringen. „Um die Empfehlung anwenden zu können, muss man zunächst herausfinden, ob das persönliche Risiko, in den nächsten 15 Jahren an Darmkrebs zu erkranken, unter oder über drei Prozent liegt. Die derzeitigen Vorhersagemodelle sind aber dahingehend noch sehr fehlerhaft“, kritisiert etwa Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.
„Ein detaillierteres Verständnis der Risikofaktoren wird Risiko-basierte Ansätze künftig verbessern können“, betont auch Autier. (The BMJ Rapid Recommendations, 2019; doi: 10.1136/bmj.l5515)
Quelle: BMJ/ Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie
4. Oktober 2019
- Daniela Albat