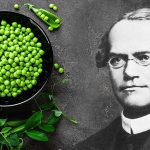Seit fast 200 Jahren ist ungeklärt, wer Kaspar Hauser war und warum er in völliger Isolation aufgezogen wurde. Jetzt bringen DNA-Analysen neues Licht in den Fall. Die mitochondriale DNA von zehn Haarproben und einer Blutprobe widerlegt die gängigste Theorie zur Herkunft Hausers. Demnach kann der junge Mann kein entführter Prinz aus dem Hause Baden gewesen sein – die DNA stimmt nicht mit der dieses Adelsgeschlechts überein, wie das Forschungsteam berichtet. Doch wer war er dann?
Im Jahr 1828 tauchte in Nürnberg ein junger, geschwächter und der Sprache kaum mächtiger Jugendlicher scheinbar aus dem Nichts auf. Er wusste weder, wer er war, noch woher er kam, bezeichnete sich aber als „Kaspar Hauser“. In einem Brief, den er bei sich trug, hieß es, der Junge sei seit 1812 in völliger Isolation gehalten worden – ohne jeden Kontakt zu einem Menschen. Zwar lernte Kaspar Hauser in relativ kurzer Zeit sprechen und erwies als normal intelligent, doch seine Geschichte blieb ungeklärt. Ungewöhnlich auch: Mehrfach wurde Hauser von Unbekannten angegriffen. 1833 starb er schließlich an einer ihm zugefügten Messerwunde.
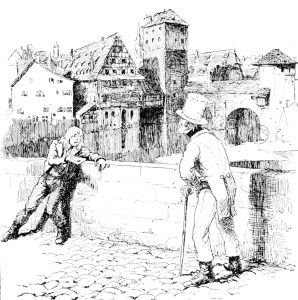
War Hauser ein entführter Prinz?
Dies nährte Gerüchte, nach denen der junge Mann möglicherweise adeliger Abstammung und Opfer einer Verschwörung gewesen sei. Demnach soll Hauser in Wirklichkeit der erstgeborene und vermeintlich kurz nach der Geburt gestorbene Sohn des Großherzogs Karl von Baden und seiner Frau Stéphanie von Beauharnais, einer Adoptivtochter Napoleons, gewesen sein. Das Kind – so die Theorie – wurde gegen einen kranken Säugling vertauscht und entführt, damit eine Nebenlinie später den Titel erben konnte.
Allerdings gab es schon zu Lebzeiten Hausers auch viele Menschen, die ihn schlicht für einen Betrüger und pathologischen Lügner hielten. Auch sein Aufwachsen in völliger Isolation – das „Kerkermärchen“ – wurde angezweifelt. Wer Hauser wirklich war, blieb auch nach seinem Tod offen. „Kaspar Hausers leben wurde eines der größten Rätsel der deutschen Geschichte“, erklären Walther Parson von der Medizinische Universität Innsbruck und seine Kollegen.