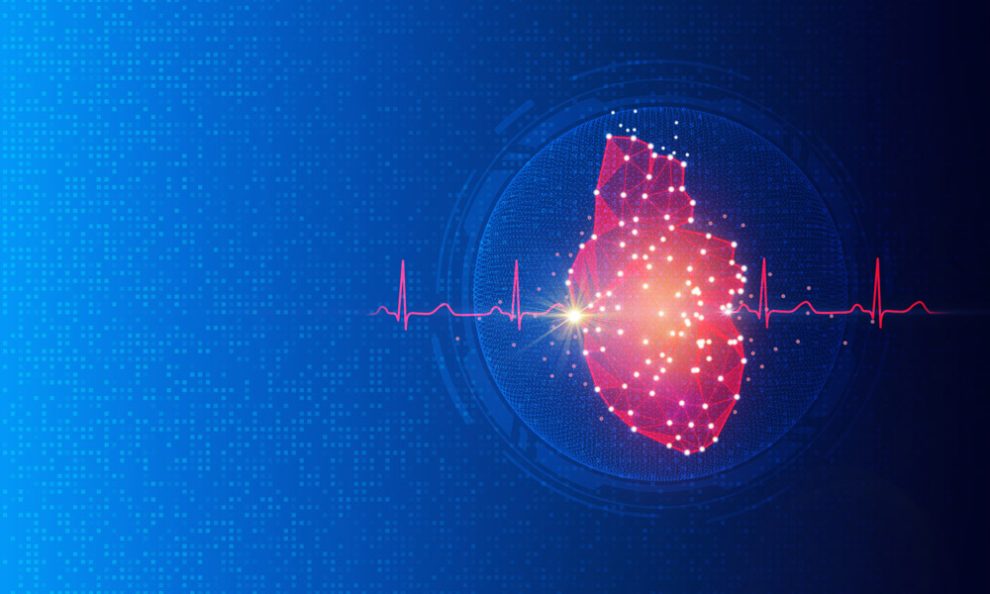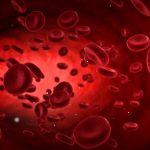Warum wurde der Herzschlag von Zebrafischen untersucht?
Um herauszufinden, wie der Ablauf tatsächlich ist, untersuchten die Forschenden die Herzzellen von sich entwickelnden Zebrafischembryos. Die Tiere sind beliebte Modellorganismen in der Forschung, weil sie schnell wachsen, klein und durchsichtig sind, was ihre Beobachtung erleichtert. Der erste Herzschlag tritt bei den Zebrafischen bereits nach rund 20 Stunden auf.
Mit Hilfe von fluoreszierenden Proteinen und Hochgeschwindigkeitsmikroskopen erfassten die Forschenden, wie sich der Calciumspiegel und die elektrische Aktivität in den Zellen der Fischembryos innerhalb sehr kurzer Zeitspannen veränderte. Pro Experiment untersuchte das Team bis zu 39 Fische, davon bis zu 18 gleichzeitig.
Erster Herzschlag erfolgt synchron
Dabei zeigte sich, dass – anders als zuvor spekuliert – alle Herzzellen abrupt, gleichzeitig und synchron zu schlagen begannen, während der Calciumspiegel deutlich wellenförmig an- und abstieg und es zu einem elektrischen Signal kam. „Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt“, beschreibt es Cohen. Weitere Experimente zeigten jedoch minimale zeitliche Unterschiede: Bei jedem Herzschlag begann zuerst eine Region des Herzens zu schlagen und löste damit eine Welle von Elektrizität aus, die rasch durch den Rest der Zellen floss und diese ebenfalls zum Schlagen veranlasste.
Das Team beobachtete zudem, dass dieser Vorgang bei verschiedenen Zebrafischen und verschiedenen Herzschlägen desselben Tieres an unterschiedlichen Stellen des Herzens begann. Die ersten Schläge erschienen dadurch zunächst noch in unregelmäßigen Intervallen und in geringerer Frequenz als bei ausgewachsenen Fischen (etwa sieben statt 30 Schläge pro Minute).
So sieht der erste Herzschlag eines Zebrafisch-Embryos aus. © nature video
Embryonenherzen unterscheiden sich von erwachsenen Herzen
Jia und seine Kollegen schließen daraus, dass die Herzzellen, die in Embryos zuerst aktiv sind, noch nicht anatomisch festgelegt sind. Diese Erkenntnis hatten sie nicht erwartet, da sich Zellen in ausgewachsenen Herzen anders verhalten: Sie werden beim Schlagen durch spezialisierte Schrittmacherzellen im Herzen koordiniert.
Die Zellen der Embryos müssen jedoch noch vor ihrem ersten Herzschlag unabhängig voneinander die Fähigkeiten entwickelt haben, selbst zu schlagen und die Aktivität ihrer Nachbarzellen zu spüren, schließen die Forschenden. „Die einzelnen Zellen lernen zunächst, zusammenzuarbeiten, ohne sich über ihre Aufgaben zu verständigen, und das Herz lernt zunächst, ohne Uhr den Takt zu halten“, erklärt Jia. Der Herzschlag wird aber dann aus einem scheinbar totalen Chaos heraus sehr schnell organisiert.
Rückschlüsse auf das menschliche Herz
„Die Entwicklung des Herzens wird schon seit über 2.000 Jahren erforscht, aber es ist das erste Mal, dass wir den Vorgang des ersten Herzschlags so exakt betrachtet haben“, sagt Megason. Auch wenn die Studie an Zebrafischen durchgeführt wurde, gehen die Forschenden davon aus, dass derselbe Entwicklungsprozess auch in anderen Wirbeltierarten, einschließlich des Menschen, abläuft. Dafür spreche, dass sich entwickelnde Zellen von Landwirbeltieren in früheren Studien ähnliche Eigenschaften aufwiesen.
Den grundlegenden Mechanismus des Herzschlags und seine verschiedenen Kontrollmechanismen zu kennen, sei wichtig, um künftig die Ursachen und Folgen von fehlerhaften Entwicklungen und Fehlfunktionen des Herzens beim Menschen zu untersuchen, sagt das Team um Jia. Die Erkenntnisse könnten helfen, eines Tages den Auslöser von Herzrhythmusstörungen zu identifizieren.
Zusammenhang mit dem Blutkreislauf
Bis dahin sind jedoch noch einige Fragen offen. Das Herz von Zebrafischen lernt beispielsweise vergleichsweise früh, selbstorganisiert zu schlagen: Zum Zeitpunkt des ersten strukturierten Schlags besteht der Studie zufolge noch keine Verbindung des Herzens zum Blutkreislauf und frühe Zebrafisch-Embryonen überleben auch ohne Aktivität des Herzens. Warum das so ist und ob zum Beispiel der Herzschlag Einfluss auf die Entwicklung des Kreislaufsystems hat, müssen weitere Untersuchungen zeigen. (Nature, 2023; doi: 10.1038/s41586-023-06561-z)
Quelle: Harvard Medical School
29. September 2023
- Claudia Krapp