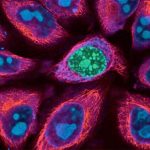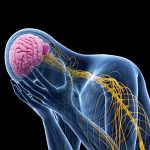Zweifache Wirkung: Die Inhaltsstoffe des Cannabis-Hanfs – darunter vor allem Cannabidiol (CBD) – wirken auf doppelte Weise entzündungshemmend: Sie bremsen die Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoffe und regen gleichzeitig die Synthese von immunregulatorischen Enzymen an. Diese hemmen überschießende Entzündungsreaktionen im Körper und tragen auch zur Gewebeheilung bei, wie Forschende herausgefunden haben. Cannabidiol könnte damit neue Therapiechancen für entzündliche Erkrankungen eröffnen.
Die Hanfpflanze Cannabis sativa produziert gleich mehrere Inhaltsstoffe, die medizinisch wirksam sind. Vor allem das nicht psychoaktive Cannabidiol (CBD), aber auch das berauschend wirkende Tetrahydrocannabinol (THC) und weitere Cannabinoide binden im Körper an spezielle Rezeptoren und können dadurch positive Effekte auf die Gesundheit haben. So wirken einige Cannabinoide nicht nur appetitanregend und schmerzlindernd, sie können auch Krämpfe lösen, Übelkeit lindern und sogar Krebszellen abtöten.
Alle acht Cannabinoide hemmen Entzündungen
Schon länger gibt es zudem Hinweise darauf, dass Cannabis-Inhaltsstoffe auch entzündungshemmend wirken können. Welche Cannabinoide dies sind und welcher Mechanismus dahintersteckt, war jedoch unklar. Deshalb sind Lukas Peltner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seine Kollegen dieser Frage nachgegangen. Für ihre Studie haben sie zunächst in Zellkulturen untersucht, wie acht verschiedene Cannabinoide, darunter auch CBD und THC, auf Immunzellen und die von diesen produzierten Botenstoffe wirken.
Das Ergebnis: Alle acht Cannabinoide zeigen eine entzündungshemmende Wirkung. „Es zeigte sich, dass sämtliche untersuchten Substanzen die Bildung von entzündungsfördernden Botenstoffen in den Zellen hemmen und zugleich die Bildung von entzündungsauflösenden Botenstoffen verstärken“, berichtet Peltner. Im Speziellen hemmten die Hanf-Inhaltsstoffe die Produktion der pro-inflammatorischen Leukotriene und förderten die Synthese von dämpfend wirkenden Immunmediatoren.