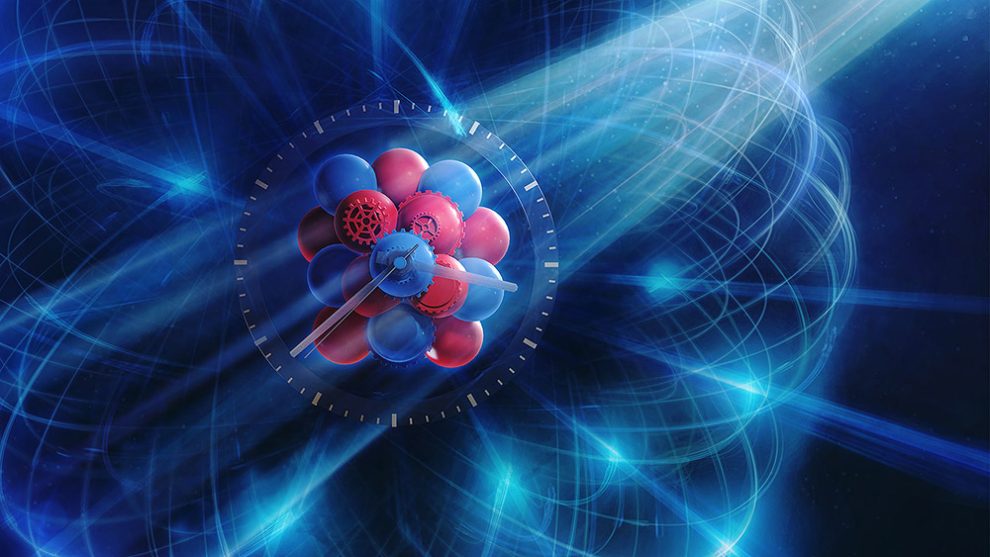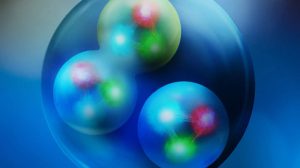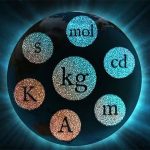Atomkern als Zeitmesser: Physikern ist ein wichtiger Schritt zu einer Scandium-Atomkernuhr gelungen – einer genaueren Form der Atomuhr, bei der der Atomkern selbst als Taktgeber dient. Das Seltenerdmetall Scandium gilt dafür schon länger als vielversprechender Kandidat. Jetzt haben die Physiker den Energieübergang des Scandium-Kerns mithilfe des Röntgenlasers XFEL erstmals mit hoher Präzision gemessen, wie sie in „Nature“ berichten. Dies schafft die Basis für die weitere Entwicklung dieser neuartigen Atomkernuhr.
Atomuhren sind die Basis unserer Zeitmessung. Als Taktgeber nutzen sie Zustandswechsel angeregter Elektronen in der Hülle von Cäsium-, Strontium- oder Ytterbium-Atomen. Solche optischen Atomuhren sind so genau, dass sie in 15 Milliarden Jahren nicht eine Sekunde vor oder nachgehen würden. Doch es ginge noch genauer: Bei einer Atomkernuhr dienen die Protonen und Neutronen in Atomkernen als Taktgeber. Dadurch könnten diese Uhren präziser und schneller „ticken“ als Elektronen-basierte Atomuhren. Als geeignetes Atom für eine solche Atomkern-Uhr galt bislang vor allem das Isotop 229Thorium.

Seltenerdmetall Scandium als Taktgeber?
Doch jetzt gibt es einen weiteren Kandidaten: das Seltenerd-Metall Scandium. „Das wissenschaftliche Potenzial der Scandium-Resonanz wurde bereits vor mehr als 30 Jahren erkannt“, berichtet Erstautor Yuri Shvyd’ko vom Argonne National Laboratory in den USA. Denn die Kernbausteine dieses Atoms zeigen einen scharf abgegrenzten Energieübergang, der sich nur über eine Bestrahlung mit Röntgenstrahlung einer sehr schmalen Bandbreite auslösen lässt. Physikalisch ausgedrückt: Die Linienbreite der Anregungsfrequenz liegt bei nur 1,4 Billiardstel Elektronenvolt.
„Die Qualität dieses Kernübergangs liegt damit um Größenordnungen über anderen messbaren Resonanzen dieser Art“, erklären die Wissenschaftler. Theoretisch wäre mit einer Scandium-Atomkernuhr dadurch eine Genauigkeit von eins zu zehn Trillionen möglich. „Sie würde dadurch maximal eine Sekunde pro 300 Milliarden Jahren vor oder nachgehen, wie Koautor Ralf Röhlsberger vom Helmholtz-Institut Jena erklärt. Ein weiterer Vorteil: Das für eine solche Atomkern-Uhr nötige 45Scandium ist stabil und reichlich verfügbar.