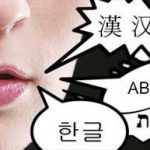Kein simpler Umkehrschluss: Indem wir ein „nicht“ davorsetzen, können wir theoretisch jedes Adjektiv verneinen, um sein Gegenteil zu beschreiben. In unserem Gehirn kommt dabei jedoch ein anderes Signal an, wie eine neue Studie zeigt. „Kalt“ ist beispielsweise für unser Denkorgan etwas anderes als „nicht heiß“. Wie wir einen Zustand beschreiben, beeinflusst demnach die Art und Weise, wie unser Gehirn diesen interpretiert. Wie funktioniert die Verneinung auf neuronaler Ebene?
Im Alltag nutzen wir häufig Verneinungen, um Objekte oder Situationen zu beschreiben: Das Wasser ist zum Beispiel nicht kalt, ein Raum nicht hell und die Lage nicht schlecht. Doch wie unser Gehirn solche verneinten Adjektive verarbeitet, ist bislang kaum erforscht. Frühere Studien deuten darauf hin, dass die Neuronen im Gehirn negierte Phrasen langsamer und mit mehr Fehlern verarbeiten als ihre positiv formulierten Gegenstücke. Künstliche neuronale Netze scheinen mit Verneinungen hingegen keine Schwierigkeiten zu haben. Warum aber verarbeitet unser Gehirn Negationen anders als ein Computer? Was passiert dabei auf neuronaler Ebene?
Unser Gehirn erkennt Verneinungen nur langsam
Um das herauszufinden, hat ein Team um Arianna Zuanazzi von der New York University nun ein Experiment mit 78 Testpersonen durchgeführt. Die Teilnehmenden sollten verschiedene bejahende oder verneinte Adjektive auf einem Bildschirm lesen und deren Bedeutung auf einer Skala von eins (sehr negativ) bis zehn (sehr positiv) bewerten. Zum Beispiel sollten sie die Wörter „gut“ und „schlecht“ sowie ihre Verneinungen „nicht gut“ und „nicht schlecht“ einordnen. Die Forschenden verfolgten dabei die Mausbewegungen der Testpersonen auf dem Bildschirm.
Dabei zeigte sich: Bei negierten Adjektiven wie beispielsweise „nicht glücklich“ antworteten die Testpersonen tatsächlich langsamer und interpretierten deren Bedeutung unterschiedlicher als bei affirmativen Wörtern wie „glücklich“. Zudem tendierten die Probandinnen und Probanden zunächst dazu, die verneinten Adjektive als bejahend zu verstehen, bevor sie ihr Kreuz auf der Skala bei der entgegengesetzten Bedeutung setzten, wie die Mausbewegungen verrieten. Eine Wiederholung dieses Experiments mit 55 anderen Personen ergab dasselbe Ergebnis.