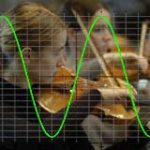Die 30 Probanden sollten für das Experiment beliebige Ohrwürmer nachsingen oder -summen, die ihnen durch den Kopf gingen, und ihren Gesang dabei auf ihrem Smartphone aufzeichnen. So entstanden zu verschiedenen Tageszeiten spontane Tonaufnahmen, ohne gezielte Aufforderung, ein bestimmtes Lied zu singen. Evans und seine Kollegen werteten diese Aufnahmen anschließend aus und überprüften, wie genau die Testpersonen jeweils die Töne trafen.
Verstecktes „perfektes Gehör“ ist weit verbreitet
Dabei zeigte sich, dass ein bemerkenswerter Anteil der spontan gesungenen Ohrwürmer perfekt mit der Tonhöhe der Originalsongs übereinstimmte. Bei 44,7 Prozent der Aufnahmen fanden die Psychologen keinerlei Tonhöhenfehler und 68,9 Prozent der Lieder wichen nur um maximal einen Halbton vom Original ab. „Dies zeigt, dass ein überraschend großer Teil der Bevölkerung über eine Art automatisches, verstecktes ‚perfektes Gehör‘ verfügen“, erklärt Evans.
Keiner der Teilnehmenden war Musiker oder berichtete, ein perfektes Gehör zu haben. Die Testpersonen trafen die Tonhöhen auch nicht genauer, wenn sie objektiv besser singen konnten, wie Vergleichstests ergaben. Demnach waren keinerlei besondere musikalische Fähigkeiten erforderlich, um die Ohrwürmer akkurat nachzusingen, wie die Forschenden betonen. Auch musikalisch Untalentierte können demnach dieses grundlegende „perfekte Gehör“ besitzen.
Unser Gehirn merkt sich Musik anders als Ereignisse
„Diese Erkenntnisse liefern den ersten Beweis dafür, dass das absolute Gehörgedächtnis automatisch erfolgt und keiner bewussten Anstrengung bedarf“, schreiben die Forschenden. Aber wie kommt dieses perfekte Gehör zustande? Bei Ereignissen speichert unser Gehirn die Informationen für gewöhnlich über Abkürzungen und ohne Details ab, um nur den Kern des Erlebnisses im Langzeitgedächtnis zu erfassen. Bei Musik könnte das hingegen anders sein, wie der Test nahelegt. Demnach könnten musikalische Erinnerungen auf besondere Weise in unserem Gehirn kodiert und aufrechterhalten werden.
„Musik klingt in verschiedenen Tonarten sehr ähnlich, daher wäre es eine gute Abkürzung für unser Gehirn, die Information über die ursprüngliche Tonhöhe einfach zu ignorieren und sich nur die Melodie zu merken“, erklärt Seniorautor Nicolas Davidenko von der University of California. Aber wie sich in dem Experiment herausgestellt hat, ignoriert unser Gehirn die Tonhöhe nicht. Im Gegenteil: „Musikalische Erinnerungen sind tatsächlich hochgenaue Repräsentationen, die sich der ansonsten typischen Gedächtnisbildung widersetzen“, schließt Davidenko.
Mehr Mut zur Musik
Warum das so ist, wollen Evans und seine Kollegen nun in Folgestudien näher untersuchen. Dabei möchten sie auch erforschen, ob es einen Zusammenhang mit dem Tempo gibt. Denn in sozialen Medien wie TikTok ist es üblich, Lieder schneller oder langsamer als normal abzuspielen, was sich auch auf die Tonhöhe auswirkt. Dadurch könnten die Ohrwürmer in unserem Kopf theoretisch in verschiedenen Versionen existieren.
Die Forschenden hoffen, dass durch ihre Erkenntnisse mehr Menschen das Selbstvertrauen entwickeln, Musik zu machen. Denn Musik ist nachweislich förderlich für Körper und Geist. „Viele Menschen lassen sich nicht auf die Erfahrung von Musik und Gesang ein, weil sie glauben oder ihnen gesagt wurde, dass sie es nicht können“, sagt Evans. „Aber in Wirklichkeit muss man nicht Beyoncé sein, um singen zu können. Unser Gehirn macht bereits einiges davon automatisch.“ (Attention, Perception, & Psychophysics, 2024; doi: 10.3758/s13414-024-02936-0)
Quelle: University of California – Santa Cruz
20. August 2024
- Claudia Krapp