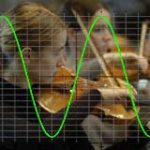Hirnregion reagiert auf akustische und mechanische Schwingungen
Es zeigte sich, dass ein Teil des Colliculus inferior (LCIC) nicht nur beim weißen Rauschen aktiv wurde, sondern auch dann, wenn die Haut der Mäuse in hochfrequente Schwingung versetzt wurde. „Wir stellen fest, dass eine Region im Colliculus inferior Schwingungen verarbeitet, sei es in Form von Schallwellen, die auf das Innenohr wirken, oder mechanische Schwingungen, die auf die Haut wirken“, sagt Seniorautor David Ginty von der Harvard Medical School.
Demnach ist dieses Hirnareal neben dem Hörsinn auch an der Verarbeitung von Berührungen und dem Tastsinn beteiligt, schließt das Team. Nervensignale von mechanischen Reizen erhält der Colliculus inferior jedoch nur ab einer bestimmten Frequenz der Vibrationen, wie Huey und ihre Kollegen feststellten. Normalerweise senden die ultra-sensitiven Mechanorezeptoren der Haut, die sogenannten Vater-Pacini-Körperchen und Meissner-Körperchen, ihre Reizsignale an die für Tastreize zuständigen Hirnareale. Doch die Tests zeigten nun, dass dies vorwiegend bei niedrig-frequenten Schwingungen unter 200 Hertz und eher über die Meissner-Körperchen geschieht.
Auf höherfrequente Schwingungsreize, wie sie bei Musik auftreten, reagieren hingegen überwiegend die Vater-Pacini-Körperchen. Sie leiten diese Signale dann vor allem an den Colliculus inferior weiter, wie die Tests ergaben. In Mäusen, denen diese Rezeptoren fehlen, zeigte sich entsprechend keine solche Hirnaktivität.
Doppelreiz mit Verstärkereffekt
Der Colliculus inferior ist demnach sowohl am Hören wie auch am „Erspüren“ von Musik beteiligt. Doch damit nicht genug: „Wenn auditive und mechanische Schwingungssignale in dieser Gehirnregion zusammenlaufen, verstärken sie die sensorische Erfahrung und machen sie deutlicher“, berichtet Ginty. „Tatsächlich haben wir beobachtet, dass Neuronen im Colliculus inferior stärker auf kombinierte taktil-auditive Stimulation reagierten als auf eines von ihnen allein.“
Bei hörenden Menschen zeigt sich diese Fähigkeit unter anderem auf Konzerten, wenn wir die Musik gleichzeitig fühlen und hören. Dabei arbeiten Gehirn und Körper zusammen, um mehrere Empfindungen gleichzeitig zu verarbeiten. Huey und ihre Kollegen gehen davon aus, dass der Verstärkereffekt auch für uns Menschen gilt, da auch wir Vater-Pacini-Körperchen besitzen, die auf hochfrequente Schwingungen reagieren. „Beim Menschen befinden sich diese Rezeptoren tief in der Haut der Fingerspitzen und Füße“, erklärt Huey.
Warum Beethoven Musik „hören“ könnte
Bei Menschen mit Hörverlust kommt es in den sensorischen Arealen des Gehirns zu Anpassungen: Bereiche, die für die Verarbeitung anderer Reize zuständig sind, weiten sich aus, das Areal für akustische Reize wird kleiner. In Kombination mit der Doppelfunktion des Colliculus inferior könnte dies erklären, warum Beethoven und andere schwerhörige und gehörlose Menschen trotz Hörverlust noch Musik „hören“ können: Auch die geänderten Nervenverknüpfungen im Gehirn erzeugen Reizmuster, die das Hirnareal doppelt reizen und so das Empfinden verstärken.
Mit dem Wissen könnten nun neue Prothesen für Menschen mit Hörverlust entwickelt werden, die deren Tastsinn zusätzlich unterstützen. „Geräte, die Schall in mechanische Schwingungen innerhalb des pacinischen Frequenzbereichs umwandeln, könnten Menschen eine größere Fähigkeit verleihen, Klang wahrzunehmen und zu erleben“, sagt Ginty. Solche Hörhilfen könnten für Hände, Arme, Füße, Beine oder andere Körperstellen mit Vater-Pacini-Körperchen konzipiert werden.
Phänomen erfüllt biologischen Zweck
Aber wozu diente diese Fähigkeit, Geräusche gleichzeitig zu hören und zu fühlen, ursprünglich? Frühere Studien legen nahe, dass Tiere diese Fähigkeit entwickelt haben, um Veränderungen in ihrer Umwelt und Gefahren besser erkennen zu können. Denn wer besser hört, kann auch besser reagieren und überlebt eher. Beispielsweise „hören“ Schlangen die Bewegungen von Beute und Feinden, indem sie die dabei auftretenden Schwingungen im Erdboden mit ihrem Kiefer spüren. Elefanten spüren ebenfalls schon kleinste Schwingungen im Boden über die Haut an Rüssel und Fußballen.
In Folgestudien wollen die Forschenden untersuchen, ob sich auch bei Tieren der Tastsinn verstärkt, wenn sich ihr Hörsinn verschlechtert. (Cell, 2024; doi: 10.1016/j.cell.2024.11.014)
Quelle: Harvard Medical School
20. Dezember 2024
- Claudia Krapp