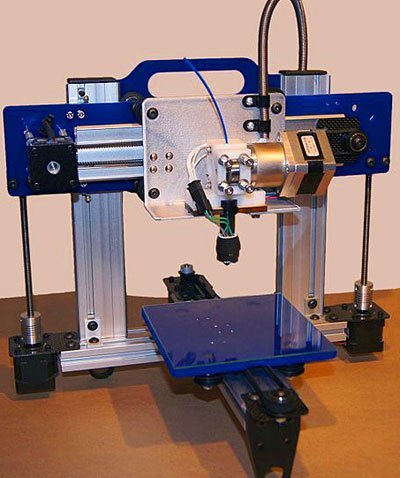Die 3D-Drucker sind auf dem Vormarsch. Flugzeugbauteile, Werkzeuge, Spielzeug – immer mehr Produkte können wir mit Hilfe dieser Geräte einfach selbst herstellen. Diese Form des „Do-it-Yourself“ gilt daher vielfach als die Produktion der Zukunft. Ob dieser Hype berechtigt ist und was das für die Umwelt bedeuten würde, haben Forscher des Öko-Instituts nun untersucht.
3D-Drucker sind im Trend. Die Geräte, mit denen sich dreidimensionale Formen produzieren lassen, gelten als die Produktionsmethode der Zukunft. Einige Enthusiasten rufen sogar schon die nächste industrielle Revolution aus. Denn statt Fabriken und langer Fertigungsketten kann mit Hilfe dieses additiven Manufacturings, wie es auch bezeichnet wird, im Prinzip jeder genau die Objekte herstellen, die er gerade benötigt. Rohmaterial und ein virtuelles 3D-Modell reichen.
Anfangs war 3D-Druck eine reine Kunststoffangelegenheit. Aber auch Metallobjekte wie Handygehäuse, Figuren oder Werkzeuge lassen sich damit mittlerweile produzieren. Die Vorteile sind klar: Das Drucken in 3D spart Lagerhaltung, Transportkosten und reduziert Verpackungen. Und auch für die Umwelt könnten 3D-Drucker eine Chance bedeuten, wenn sie Ressourcen einsparen und weniger Energie verbrauchen.
„Trotz vieler erster praktischer Anwendungen mit der Technik sehen wir heute, dass sie noch in den Kinderschuhen steckt“, fasst Hartmut Stahl, Experte für Stoffstromanalysen am Öko-Institut in Freiburg zusammen. „Gerade bei der Bewertung des Umweltpotenzials für den Klima- und Ressourcenschutz sind noch viele Fragen offen.“ Ob der Hype daher berechtigt ist und was 3D-Drucker auch in ökologischer Hinsicht für Vorteile bringen könnten, das haben Stahl und seine Kollegen nun genauer analysiert.