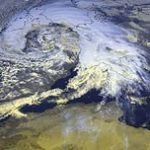Wie weit zieht die Aschewolke eines Vulkanausbruchs? Und wie stark bedroht sie die Flugsicherheit? Diese Fragen und die mit ihnen verbundenen Unsicherheiten führten im April 2010 nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull zu einem europaweiten Flugverkehrs-Chaos. Jetzt haben Forscher Ausbreitungs-Simulationen mit verschiedensten Messwerten verglichen und die Quelle des Problems ausfindig gemacht: zu wenig Informationen vom Ausbruchsort. Denn das Wissen um die Höhe der Eruptionswolke sowie die genauen Partikelgrößen und -konzentrationen am Ausbruchsort sind mitentscheidend für die Qualität der Ausbreitungsprognose.
Nach dem Ausbruch des Eyjafjallajökulls im April/Mai 2010 hatten die Behörden sicherheitshalber große Teile des europäischen Luftraumes gesperrt, was in der ersten Woche zu mehr als 100.000 ersatzlos gestrichenen Flügen geführt hatte. Das entstandene Verkehrschaos hatte heftige Kritik bei Fluggesellschaften und Passagieren ausgelöst, da sich die Behörden dabei lediglich auf Ausbreitungsmodelle gestützt hatten. Auch beim Ausbruch des isländischen Vulkans Grimsvötn im Mai 2011 gab es kurzzeitige Sperrungen des Luftraumes, die sich auf die Modelle des Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) in London stützten. Die Qualität solcher Ausbreitungsmodelle ist daher von großer
Bedeutung für den Luftverkehr.
Simulation und Messwerte im Vergleich
Im Gegensatz zu Sandstaub kann die Vulkanasche in den Triebwerke moderner Flugzeuge schmelzen und diese dabei ernsthaft beschädigen. Aus Sicherheitsgründen wurden daher Grenzwerte für die Konzentration der Asche festgelegt: Bei Konzentrationen unter 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird davon ausgegangen, dass kein Risiko für den Flugverkehr besteht. Ab Konzentrationen von 2000 Mikrogramm pro Kubikmeter ist der Flugverkehr dagegen verboten. Ausbreitungsmodelle müssen daher nicht nur den Weg und die Geschwindigkeit der Aschewolke vorhersagen, sondern auch die Konzentration der Aschepartikel.