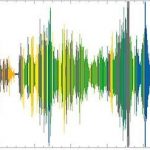Ein neuartiges Nano-Tomographieverfahren erlaubt erstmals Untersuchungen feinster Strukturen im Nanometerbereich. So können selbst dreidimensionale Innenansichten fragiler Knochenstrukturen erstellt werden. Die ersten mit diesem Verfahren erzielten Nano-CT-Bilder wurden nun in „Nature“ veröffentlicht. Die neue Technik kann unter anderem beid er Früherkennung von Osteoporose helfen, aber auch in anderen Bereichen der Medizin wertvolle Einblicke liefern.
Osteoporose, auch Knochenschwund genannt, ist eine der häufigsten Erkrankungen des alternden Knochens: In Deutschland ist etwa ein Viertel der Bevölkerung über 50 Jahre davon betroffen. Bei den Patienten schrumpft die Knochensubstanz übermäßig rasch, damit steigt das Risiko für Brüche deutlich. In der klinischen Forschung wird Osteoporose bisher fast ausschließlich über die Messung einer allgemein verringerten Knochendichte bestimmt. Diese sagt jedoch wenig über die damit verbundenen und ebenso wichtigen lokalen Struktur- und Knochendichte-Änderungen aus.
Computertomografie weiterentwickelt
Ein Forscherteam um Franz Pfeiffer, Professor für Biomedizinische Physik an der Technischen Universität München, hat dieses Dilemma nun gelöst: „Mit unserem neu entwickelten Nano- CT-Verfahren ist es jetzt möglich, die Struktur- und Dichte-Änderungen des Knochens hochaufgelöst und in 3D darzustellen. Damit kann man die der Osteoporose zugrunde liegenden Strukturänderungen auf der Nanoskala erforschen und bessere Therapieansätze entwickeln.“
Pfeiffers Team hat bei der Entwicklung auf der Röntgen-Computertomographie (CT) aufgebaut. Ihr Prinzip ist seit langem bekannt – CT-Geräte werden im Krankenhaus und in der Arztpraxis tagtäglich zur diagnostischen Durchleuchtung des menschlichen Körpers verwendet. Hierbei wird der Körper mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Ein Detektor misst dabei unter verschiedenen Winkeln, wie viel Röntgenstrahlung jeweils absorbiert wird. Im Prinzip werden einfach Röntgenbilder aus verschiedenen Richtungen aufgenommen. Aus einer Vielzahl solcher Aufnahmen können dann mittels Bildverarbeitung digitale 3D-Bilder des Körperinneren erzeugt werden.