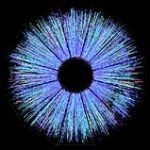Einer internationalen Wissenschaftlerkollaboration ist es erstmals gelungen, vier Atome des Kerns Hassium-270 zu synthetisieren und nachzuweisen. Dieses, jetzt in der Zeitschrift „hysical Review Letters“ veröffentlichte Experiment belegt, dass der Weg zu superschweren Elementen über eine näher gelegene, durch so genannte Schaleneffekte stabilisierte Region führt. Auch Chemikern steht somit die Erforschung aller bisher nur mit physikalischen Methoden nachgewiesenen Elemente im Periodensystem offen.
Das schwerste in größeren Mengen in der Natur vorkommende Element ist Uran mit der Ordnungszahl 92. Forscher fragen jedoch: Wie schwer kann ein Kern werden, ohne spontan in zwei Fragmente zu zerfallen? Und gibt es nicht doch weitaus schwerere Elemente, die sich eventuell sogar in der Natur nachweisen lassen? In den letzten Jahrzehnten konnten Wissenschaftler an Beschleunigern wenige Atome bis hin zum Element 118 künstlich synthetisieren, indem sie leichtere Elemente fusionierten.
„Magische Zahlen“ machne Elemente stabil
Die schwersten so hergestellten Elemente sind jedoch alle radioaktiv und bestehen jeweils nur für kurze Zeit. Ihre Existenz verdanken sie dem sogenannten Schaleneffekt: "Magische" Zahlen von Protonen und Neutronen sind in der Lage, einen Kern zusätzlich zu stabilisieren. Kerne, die sowohl eine magische Protonenzahl als auch eine magische Neutronenzahl enthalten, sind "doppelt magisch".
Der schwerste bekannte doppelt magische Kern ist Blei mit der Massenzahl 208. Bereits in den 1960-er Jahren wurde auf Basis des Schalenmodells des Kerns vorhergesagt, es müsse eine Insel der superschweren Elemente geben. Zentrum dieser Insel sollte ein sphärischer, doppelt magischer Kern mit der Ordnungszahl 114 und der Neutronenzahl 184 sein. Anzeichen für die tatsächliche Existenz dieser Region erhöhter Stabilität sind Berichte über eine Serie von Experimenten des Flerov-Labors im russischen Dubna, in denen die Synthese der Elemente 112 bis 118 geglückt sein soll.