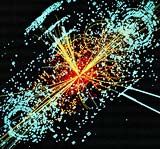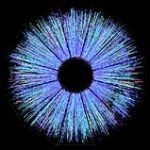Die große Hoffnung der Teilchenphysiker ruht auf einem gigantischen Magnetring nahe der Stadt Genf: Der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC) soll ab 2008 Protonen mit bisher unerreichter Energie aufeinander prallen lassen. Jetzt sind die ersten Bestandteile eines Herzstücks der Anlage, des Detektors CMS (Compact Muon Solenoid) fertig geworden.
Der hausgroße, 12.000 Tonnen schwere Elementarteilchen-Detektor CMS fängt die bei den Kollisionen entstehenden Teilchen auf und identifiziert sie. Herzstück von CMS ist ein Spurendetektor, der die Bahnen der Teilchen aufzeichnet, die explosionsartig den Kollisionspunkt verlassen. Er ist aus 25.000 Siliziumsensoren zusammengesetzt – etwa ein Fünftel haben in elfjähriger Arbeit Wissenschaftler der Universität und des Forschungszentrums Karlsruhe jetzt entwickelt, hergestellt und getestet. Der Einbau des weltgrößten Spurendetektors und die Endmontage des CMS-Detektors werden noch etwa ein Jahr dauern.
Suche nach dem Rätsel-Teilchen
Der Detektor soll den Geheimnissen der kleinsten Teilchen und damit der Frage nach Ursprung und Zusammensetzung des Universums nachgehen. Dazu zählt die Suche nach dem Higgs-Teilchen (Higgs-Boson), von dem Physiker annehmen, dass es die Masse aller Materie verursacht. Daneben wollen Physiker mit CMS auch Teilchen nachweisen, aus denen die unsichtbare Dunkle Materie besteht, die etwa ein Viertel der Gesamtmasse des Universums ausmacht. Der CMS-Detektor ist einer von vier großen Detektoren am LHC.
Das Higgs-Boson ist das letzte Teilchen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik, das die Physiker noch nicht nachweisen konnten. Das Modell beschreibt die fundamentalen Teilchen und die Kräfte zwischen ihnen. "Wir stellen uns vor, dass sich im Universum neben den uns vertrauten elektrischen, magnetischen und Gravitations- Feldern auch ein Higgs-Feld befindet, das Teilchen eine träge Masse verleiht", sagt Professor Dr. Thomas Müller vom Zentrum für Astroteilchen- und Elementarteilchenphysik (CETA) an der Universität Karlsruhe.