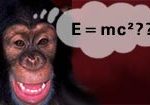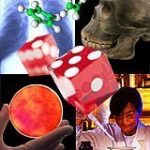Bei der Weltmeisterschaft der Männer war es Krake Paul, jetzt sind es Fruchtfliegen: Würzburger Fliegenforscher lassen ihre Tiere mittels einer virtuellen Arena die anstehenden Spiele vorwegnehmen. Wie oft die Fliegen den Ball in eines der mit den Landesflaggen dekorierten Tore bringen könnte sich als Omen für das tatsächliche Spiel erweisen. Beim ersten Spiel der deutschen Frauen lagen die Tiere zumindest beim Ergebnis, wenn auch nicht bei den Toranzahl richtig: Sie tippten 1:0 für Deutschland. Für das Spiel gegen Nigeria lautet die Fliegen-Prognose 1:1.
Wissenschaftler am Rudolf-Virchow-Zentrum in Würzburg hoffen, mithilfe eines Fliegenorakels den Ausgang der Fußball-WM der Frauen vorherzusehen. Die Vorhersage eines Spielergebnisses durch die Fliegen dauert dabei genau 120 Sekunden. Während dieser Zeit bewegt sich die Fliege auf einem sogenannten Buchner-Ball in einer künstlichen Arena. Die beiden Tore werden durch die Landesflaggen der spielenden Mannschaften repräsentiert. Die Drehungen des Balles, die die Fliege erzeugt, werden erfasst und daraus die beabsichtigten Bewegungen der Fliege errechnet. Entsprechend dieser Daten ändert sich das Panorama der virtuellen Arena. Erreicht die Fliege eines der beiden Tore, so wird dies als erfolgreicher Torschuss gewertet.
Sieg im ersten Spiel vorhergesagt
„Krake Paul hat nur Futter gefressen. Doch unsere Fliegen spielen tatsächlich Fußball. Daher haben wir vollstes Vertrauen in die Ergebnisse“, so die Initiatoren der Aktion. „Normalerweise erforschen wir an unseren Fliegen, wie Verhalten entsteht. Intelligente Tiere also – ideale Voraussetzungen für ein Orakel.“ Fünf Spiele haben die Fruchtfliegen bereits vorausgesagt, das erste Spiel der Deutschen allerdings nicht ganz zutreffend mit 1:0 für die Gastgeberinnen – aber immerhin in punkto Sieg lagen die Fliegen richtig. Für das kommende Spiel Deutschland – Nigeria tippten die Fliegen 1:1.
Verhaltensforschung einmal anders
Die Idee für das Orakel entwickelt und umgesetzt haben der Diplomand Sebastian König und der Doktorand Till Andlauer vom Forschungszentrum für experimentelle Biomedizin an der Universität Würzburg. Normalerweise beschäftigen sich die Forscher hier mit der Frage, wie bestimmte Verhaltensweisen entstehen und welche Rolle Gehirn und Gene dabei spielen.