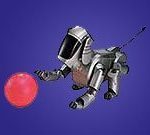Neuroprothesen gehören heute zu den technisch spannendsten und hilfreichsten Systemen in der Medizin. Dabei werden technische Systeme an Nerven angekoppelt, um beispielsweise Organe oder Gliedmaße zu stimulieren. Eine Studie der VDE-Initiative MikroMedizin belegt nun, dass insbesondere in Deutschland dieser Forschungszweig großes Zukunftspotenzial hat.
Wenn körpereigene Schaltstellen – etwa durch Krankheit oder Unfall – nicht mehr funktionieren, können miniaturisierte elektronische Implantate Nervenstrukturen oder deren Funktionen modulieren, überbrücken oder auch ersetzen. Die eingebaute Messtechnik erfasst dabei körpereigene und verwandelt sie in elektronische Signale, die Muskeln oder Nervenzentren stimulieren oder technische Systeme wie zum Beispiel eine „künstliche Hand“ steuern. Sogar Rückkopplungen sind möglich: Sensoren einer Handprothese können die Temperatur des ergriffenen Gegenstands an einen im Unterarm implantierten Mikroprozessor melden, so dass in den entsprechenden Hirnarealen das Gefühl von Hitze ankommt („Feedback“).
Laut VDE-Studie werden unter anderem fortschreitende Miniaturisierung und höhere Systemzuverlässigkeit durch integrierte Selbstfunktionstests die Zukunft bestimmen sowie – mit Hilfe der drahtlosen Datenübertragung – eine einfachere Verbindung zu Komponenten außerhalb des Körpers. Die Telemetrie spielt für die gesamte Neuroprothetik ein wichtige Rolle. Anstelle von durch die Haut geführten Kabeln geht die Entwicklung zu hochfrequenten elektromagnetischen Sendern zur Datenfernübertragung mit Reichweiten von einigen Metern. Durch die Einspeisung in vorhandene IT- und Kommunikationsnetze können Daten aus dem Körper auch über weite Strecken an eine Monitoring-Zentrale gesendet werde.
Prothesensteuerung durch „Gedankenkraft“
Mittelfristig soll es zum Beispiel Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS), in deren Endstadium der Betroffene vollständig gelähmt ist, oder Patienten mit Lähmungen der Arme oder Beine möglich sein, „durch Gedanken“ Roboterarme oder Elektrorollstühle zu steuern. Erforscht werden dabei unter anderem „Human-Computer-Interfaces“ (HCI), Schnittstellen zwischen dem Zentralnervensystem und Aktuatoren, also zum Beispiel Computer oder Extremitätenprothesen.