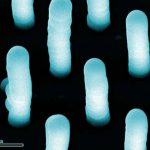Computer setzen viel Wärme frei, auch und gerade beim Löschen von Daten. Möglicherweise ist sogar schon in zehn Jahren die Grenze der Kühlbarkeit für Supercomputer erreicht. Eine Studie aus der theoretischen Physik zeigt nun Erstaunliches: Diese Wärmebildung könnte vermieden und im Idealfall sogar Kälte erzeugt werden – zumindest bei einem Quantencomputer. Denn bei ihm, so erklärt ein Physikerteam in „Nature“, entspricht die Wärme erzeugende Entropie einem „Unwissen“, das umgangen werden kann.
Wenn Rechner rechnen, produzieren sie vor allem eines: Wärme. Die Wärmeproduktion macht den Computer aus energetischer Sicht ineffizient. Der enorme Energiebedarf und die überflüssige Wärmeproduktion machen Hochleistungsrechner nicht nur teurer, sie behindern auch deren Weiterentwicklung. Der Physiker Rolf Landauer zeigte bereits 1961, dass beim Datenlöschen unweigerlich Energie in Form von Wärme freigesetzt wird. Das nach ihm benannte Landauer-Prinzip besagt, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Rechenoperationen pro Sekunde überschritten wird, der Computer so viel Wärme produziert, dass diese unmöglich abgeführt werden kann.
Kritische Grenze in zehn bis 20 Jahren erreicht
Experten gehen davon aus, dass diese kritische Grenze in den nächsten zehn bis 20 Jahren erreicht wird. Die Wärmeabgabe beim Löschen einer Festplatte von zehn Terabyte beträgt zwar prinzipiell weniger als ein Millionstel Joule. Wird ein solcher Löschvorgang aber viele Male pro Sekunde wiederholt, summiert sich die Wärme dementsprechend auf. Doch ein Forscherteam um Renato Renner von der ETH Zürich und Vlatko Vedral vom Centre for Quantum Technologies der NU Singapore hat nun herausgefunden, dass beim Datenlöschen anstatt Wärme unter bestimmten Voraussetzungen auch Kälte entstehen könnte.
Das Landauer-Prinzip, so zeigt ihre Studie, gilt nur, solange man den Wert der zu löschenden Bits nicht kennt. Das Löschen eines Speichers ist bis jetzt ein irreversibler Prozess. Wenn der Speicherinhalt jedoch bekannt ist, wäre es möglich, ihn so zu löschen, dass er theoretisch wieder herstellbar wäre. Unter diesen Umständen würde das Landauer-Prinzip nicht mehr gelten.