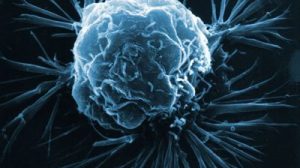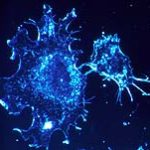Eine durchschnittlichen Handynutzung erhöht nicht das Risiko, an einem Tumor im Kopfbereich zu erkranken. Das ist das Ergebnis der bisher größten Fall-Kontrollstudie zum Thema Handys und Krebsrisiko. Im Hinblick auf Handy-Nutzer, die besonders häufig telefonieren, sind die Resultate allerdings unklar.
{1l}
Mobiltelefone (Handys) und Schnurlostelefone senden beim Telefonieren hochfrequente elektromagnetische Felder aus. Zum Schutz der Bevölkerung gibt es Grenzwerte, unterhalb derer nach derzeitigem Wissen keine Gesundheitsschäden zu erwarten sind. Nicht zuletzt auf Grund der rapiden Verbreitung des Mobilfunks werden jedoch immer wieder Befürchtungen über mögliche Risiken laut. Deshalb begannen im Jahr 2000 Forscher in acht europäischen Ländern (Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden) sowie in Australien, Israel, Japan, Kanada und Neuseeland mit einer gemeinsamen Studie, die von der „International Agency for Research on Cancer (IARC)“ in Lyon koordiniert wurde.
Befragung von Tumorpatienten und Gesunden
Diese so genannte Interphone-Studie sollte mit epidemiologischen Methoden mögliche Gesundheitsrisiken aufspüren. Weil Handys und Schnurlostelefone direkt an den Kopf gehalten werden, wollte man in erster Linie untersuchen, ob die Nutzung von Handys die Entwicklung von Hirntumoren (Gliomen und Meningeomen) bei Erwachsenen fördert. Zwischen 2000 und 2003 befragten dafür die Forscher insgesamt 2.765 Gliom- und 2.425 Meningeom-Patienten sowie 7.658 gesunde Vergleichspersonen zu ihren Telefonier-Gewohnheiten. Damit ist Interphone die bisher größte Fall-Kontrollstudie, die Handygebrauch und Tumorrisiken untersucht hat. Sie erfasste vor allem kurzzeitige Handynutzer, aber auch eine Anzahl von Personen, die bereits vor 1994 begannen, mobil zu telefonierten.
Kein erhöhtes Risiko für Durchschnitts-Telefonierer
Das Ergebnis: Insgesamt war das regelmäßige Telefonieren mit einem Handy nicht mit einem höheren Risiko für Gliome oder Meningeome verbunden. Berücksichtigt man die die gesamte Nutzungsdauer in Stunden, so zeigt sich nur bei den allerstärksten Nutzern – das entspricht rund fünf Prozent der Teilnehmer – ein erhöhtes Risiko, an einem Gliom zu erkranken, und zwar insbesondere bei denjenigen, die das Handy nach eigenen Angaben bevorzugt an die vom Gliom betroffene Kopfseite gehalten haben.
Mehr Gliome bei Vielnutzern?
„Ob für diese Personen das Risiko, an einem Hirntumor zu erkranken, tatsächlich erhöht ist, lässt sich allerdings nicht sagen, denn die Ergebnisse könnten auch durch methodische Probleme entstanden sein“, erklärt Professorin Maria Blettner, Mitglied der Interphone Study Group und Direktorin des
Instituts für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
So beruhen diese Werte auf kleinen Fallzahlen und teilweise nicht plausiblen Angaben zur Handynutzung. Möglicherweise neigen Menschen mit einem Gehirntumor dazu, ihren zurückliegenden Mobiltelefongebrauch zu überschätzen. Auch stieg das Risiko zu erkranken nicht, wie zu erwarten wäre, mit zunehmender Stundenzahl kontinuierlich an. Stattdessen war es nur für die kleine Gruppe der extremen Vieltelefonierer erhöht.
Strahlung heute geringer
Bei heutigen Handys ist die Strahlenexposition (SAR-Wert) heute deutlich geringer als noch vor zehn bis 20 Jahren, daher gehen die Wissenchaftler davon aus, dass das Risiko heute eher geringer ist als damals. „Die Interphone-Studie hat gezeigt“, so Blettner, „dass für einen Erwachsenen eine durchschnittliche Nutzung des Handys kein erhöhtes Hirntumorrisiko bedeutet.“ Ob Menschen, die besonders lange und häufig mit ihrem Handy telefonieren, gefährdet sind, an einem Gliom zu erkranken, muss nun weitere Forschung klären.
In Deutschland waren Wissenschaftler der Universität Mainz (Studienleitung), des Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und der Universität Bielefeld an der Interphone-Studie beteiligt. Die deutschen Ergebnisse wurden bereits 2006 in der Fachzeitschrift „American Journal of Epidemiology“ veröffentlicht. Die Gesamtergebnisse sind jetzt in der Fachzeitschrift „International Journal of Epidemiology“ erschienen.
(Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 18.05.2010 – NPO)