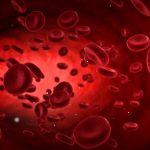Forensische Serien als Verbrechensschule? Wer regelmäßig TV-Serien wie CSI schaut, wird dadurch wohl doch nicht zwangsläufig zum besseren Kriminellen. Gleich mehrere Untersuchungen widerlegen nun den seit Jahren kursierenden Mythos des sogenannten „CSI-Effekts“. Demnach gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum solcher Serien und den Fähigkeiten, ein Verbrechen zu begehen und Spuren am Tatort zu verwischen.
„CSI-Effekt“ – so wird das Phänomen bezeichnet, wonach forensische TV-Serien wie „CSI“ den Zuschauer beeinflussen. Erkenntnisse aus der „Crime Scene Investigation“, also der Tatortermittlung im Film, könnten sich demnach im realen Leben niederschlagen. Im schlimmsten Fall, so die Befürchtung, lernen potenzielle Verbrecher, wie sie eine Tat am besten vertuschen.
Es wurden aber auch Bedenken geäußert, dass Mitglieder von US-Schwurgerichten durch die Darstellung im Film überhöhte Erwartungen an die Ermittlungsergebnisse haben könnten und in der Folge die Zahl der Freisprüche steigt. Allerdings: Ob es diesen Effekt tatsächlich gibt, ist bisher nie untersucht worden. „Die Behauptung solcher Zusammenhänge oder Auswirkungen stand jahrelang im Raum, ohne dass es irgendwelche Studien dazu gegeben hätte“, sagt Andreas Baranowski von der Universität Mainz.
Spuren verwischen für die Wissenschaft
Der Psychologe und seine Kollegen wollten das ändern und haben nun insgesamt vier Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Krimi-Fans bessere Verbrecher wären. Dafür schauten sich die Forscher zunächst Statistiken aus den Datenbanken von BKA und FBI an und verglichen die Rate der Verbrechensaufklärung in den Jahren vor dem Start der US-Serie CSI mit jener danach. Dann befragten sie 24 verurteilte Kriminelle in Gefängnissen nach ihrer Meinung zu solchen Serien und danach, ob sie diese für hilfreich erachten, um einer Strafverfolgung zu entgehen.