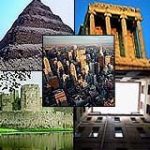Hier hat die Physikerin Kanngießer zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe für Analytische Röntgenspektroskopie eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, Hinweise zu bekommen, ob die Qumranrollen in der Siedlung der Essener hergestellt und dort auch beschrieben wurden.
Mit Röntgenfluoreszenz unter die Oberfläche schauen
„Meine Methode ist eine Weiterentwicklung der Röntgenfluoreszenzanalyse. Das Neue daran ist, dass wir in die Tiefen eines Kunstwerkes vordringen können. Wir setzen uns sozusagen unter die Oberfläche des Objektes“, erklärt Kanngießer. „Mikrometer für Mikrometer steigen wir hinein in das Objekt und können so exakt Aufschluss darüber geben, in welcher Tiefe des zu untersuchenden Gegenstandes sich in welcher Konzentration die verschiedenen Elemente befinden wie zum Beispiel Kupfer, Eisen oder Chlor. Mit der herkömmlichen Röntgenfluoreszenzanalyse konnte man diese tiefenaufgelösten Informationen über die Verteilung der Elemente nicht bekommen, sondern bisher nur sagen, wie viel Kupfer in einem Objekt vorhanden ist.“
Der „Trick“ an dem experimentellen Aufbau ist, dass sie zwei Röntgenoptiken verwendet, deren Foki gekreuzt werden. Die eine Röntgenoptik bündelt die Strahlung auf das Untersuchungsobjekt, die andere sammelt die spezifische Strahlung des Untersuchungsobjektes und führt sie zum Detektor, vor dem die zweite Röntgenoptik platziert ist. Der Detektor nun löst die spezifische Strahlung des Untersuchungsobjektes in seine Bestandteile auf.
Zerstörungsfreier Einblick in die Elementverteilung
Was sowohl die Röntgenfluoreszenzanalyse als auch ihre Weiterentwicklung für die wissenschaftliche Arbeit an unersetzlichen Kunst- und Kulturgütern so wertvoll macht, ist, dass diese Methode absolut schonend und zerstörungsfrei ist. „Ohne dass die Objekte berührt oder Proben genommen werden müssen, können sie untersucht werden“, so Kanngießer.
Durchgeführt werden die Messungen bei der Elektronenspeicherring- Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY) in Berlin. Analysiert wurden sehr wertvolle Fragmente aus dem Konvolut von Apokryphen zur Genesis, also außerbiblischen Schriften zur Genesis, sowie zahlreiche weitere kleinere Fragmente.
Tusche als Hinweis
Tatsächlich brachten die Untersuchungen wie erhofft wichtige Erkenntnisse:
Durch Messungen des Spurenelementgehalts in den Tuschen kam ans Licht, dass Fragmente mit unterschiedlichen Tuschen geschrieben worden sind. Bei einem Fund konnte so nachgewiesen werden, dass zwei bisher als zusammengehörig betrachtete Fragmente nicht zusammengehören.
Auch über den Zustand der Apokryphen zur Genesis kam Neues, wenn auch eher Alarmierendes ans Licht. So ist bei ihnen der Kupferfraß besorgniserregend vorangeschritten. Das Pergament zerbröselt regelrecht. „Wir haben den Kupferfraß auch dort orten können, wo das Dokument augenscheinlich, aber eben nur augenscheinlich, noch relativ intakt wirkt. Unter der Oberfläche jedoch, unsichtbar fürs Auge, schreitet die Zerstörung unaufhörlich voran“, so Kanngießer. Weitere Forschungen zu Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten sind dringend notwendig.
Chlor-zu-Brom-Verhältnis hilft bei Frage nach Herkunft
Die Beantwortung der Frage, wo das Pergament der einzelnen Qumranrollen hergestellt wurde – ob in der Nähe des Fundortes oder an einem ganz anderen Ort – steht jedoch noch aus. Um herauszufinden, wo das Pergament der Rollen produziert worden ist, könnte ein Glücksumstand helfen. Das Wasser in der Nähe des Toten Meeres hat ein spezifisches Chlor-zu-Brom-Verhältnis. Ungewöhnlich hoch ist hier der Bromgehalt. In Regionen, die vom Toten Meer weiter entfernt sind, ist das Verhältnis ein anderes. Wenn sich dieses spezifische Verhältnis in den Fragmenten wiederfindet, lässt sich schlussfolgern, dass das Pergament in der Nähe des Toten Meeres hergestellt worden ist.
In einigen kleineren Fragmenten konnte dieses besondere Chlor-zu-Brom- Verhältnis nachgewiesen werden „Um jedoch auch über die Herkunft der Apokryphen zur Genesis und anderen Fragmenten gesicherte Aussagen machen zu können, sind zusätzliche Messungen erforderlich“, erklärt Kanngießer. „Und wir benötigen weitere Fragmente, um zu sehen, ob dort das Chlor-zu-Brom-Verhältnis ein anderes ist. Wir müssen klären, ob es Veränderungen gibt und wenn ja, ob sie lagerungsbedingt sind, ob es Verunreinigungen gegeben hat, ob sie in Tonkrügen gefunden wurden oder auf der Erde der Höhle. Denn all das muss miteinander in Beziehung gesetzt werden, um zu wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu kommen.“ Anfang April 2008 sollen wieder Messungen in Berlin stattfinden.
(Pressemitteilung Technische Universität Berlin, 15.01.2008 – NPO)
15. Januar 2008